|
simon's solutions
peter's blog 2014 |
Für jede Ideologie gilt frei nach dem Philosophen Hegel:
Wenn die Wirklichkeit mit den Ideen kollidiert, umso schlimmer für die Wirklichkeit. |

|
2014-12-22  |
Disqualifikationskriterien für Politiker |
Vranitzky sagt
"Es gibt nur wenige berufliche Vorleben, die jemanden von Haus aus als Politiker disqualifizieren"
Vranitzky missfällt SP-Kritik an ÖBB-Chef Kern
Vranitzky missfällt SP-Kritik an ÖBB-Chef Kern
Manager zu sein disqualifiziert nicht für die Politik, richtet der Alt-Kanzler der Parteispitze aus.
Auf den ersten Blick ist nicht viel passiert am Wochenende. Die Nationalratspräsidentin und der Bundeskanzler standen Journalisten Rede und Antwort, Doris Bures im Ö1-Mittagsjournal, Die Art und Weise, wie beide mit den Gerüchten um eine Ablöse an der Parteispitze umgehen, lässt Experten und Funktionäre wie Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky freilich staunen.
Zur Erinnerung: Am Samstag hat Bures nicht nur festgehalten, Faymann sitze fest im Sattel; sie hatte obendrein erklärt, der bisweilen als Kanzler-Alternative genannte ÖBB-Boss Christian Kern habe nicht das Zeug zum Parteichef ("Er wäre kein guter Politiker"). Am Sonntag kommentierte dann Faymann die Befindlichkeiten. "Bei uns ist etwas los", sagte er über die SPÖ. Er sehe sich "fest im Sattel". Und dass Bures Kern die Kompetenz absprach, unterstrich er: "Sie wird wissen, wie er ist."
"Nicht nachvollziehbar"
Verdiente Funktionäre wie Franz Vranitzky können derlei nicht mehr nachvollziehen. "Es gibt nur wenige berufliche Vorleben, die jemanden von Haus aus als Politiker disqualifizieren", sagt Vranitzky zum KURIER.
Um als Politiker erfolgreich zu sein, sei es wichtig, "politische Vorgänge zu erkennen, zu begreifen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und sich der Aufgabe bewusst zu sein, die man für die Gemeinschaft zu erfüllen hat".
Unter Vranitzkys besten Ministern waren Manager: Rudolf Streicher und Viktor Klima. "Ich habe kein Disqualifizierungselement darin gesehen, wenn jemand vor seiner politischen Tätigkeit in einem verantwortungsvollen Beruf stand", sagt Vranitzky.
Mit dieser Ansicht sei er in der SPÖ früher nicht allein gewesen. Vranitzky: "Ich habe mich ja nicht für die Politik beworben, sondern ich bin gerufen worden, also wurde das in der SPÖ früher anders gesehen."
Auf die Frage, ob es sich die SPÖ angesichts der dünnen Personaldecke leisten könne, Spitzenleute ex cathedra für unfähig zu erklären, sagt Vranitzky: "Generell ist das Angebot an Spitzenleuten in den Parteien nicht gerade überbordend."
Schlechtes Krisenmanagement
Auch außerhalb der Partei werden die Aussagen des Duos Bures/Faymann als strategisch ausnehmend ungeschickt qualifiziert.
"Anstatt zu sagen: ,Wir sprechen nicht über Themen, die keine sind‘, wurden die Ablösegerüchte nun manifest gemacht", sagt Politik-Berater Thomas Hofer zum KURIER. "Und als Kollateralschaden hat man ÖBB-Chef Christian Kern beschädigt, indem man ihm öffentlich jede Qualifikation für die Politik absprach."
Wie Hofer ist auch Politik-Analyst Peter Filzmaier überzeugt, dass das Krisenmanagement in diesem Fall kläglich versagt hat. Das offensive Thematisieren der Ablöse-Gerüchte und die scharfe Attacke auf Kern würden die Spekulationen befeuern. "Genau das", sagt Filzmaier, "wollte man verhindern."
Bleibt die Frage: Wenn klar ist, dass keine Antwort die beste gewesen wäre, wie konnte das den Routiniers Faymann und Bures passieren? "Das ist wohl nur durch deutlich erhöhte Nervosität erklärbar", sagt Filzmaier.
Das sieht auch Heidi Glück so. Die Politik-Beraterin war Sprecherin von Kanzler Wolfgang Schüssel und sieht zwei Probleme: "Zum einen sind der Kanzler, Kern, aber auch Bures beschädigt – als parteiübergreifende Nationalratspräsidentin hält man sich bei Partei-Themen grundsätzlich eher zurück."
Weit schwerer wiege, dass die SPÖ sich thematisch eine unnötige Flanke geöffnet habe: "In einer politisch ruhigeren Phase des Jahres hat man selbst ein Negativ-Thema gesetzt."
Die von vielen allerdings als arrogant, überheblich, anmaßend, männerfeindlich, intelligenzfern und sehr situationselastisch wahrgenommenene "gute" Politikerin (die Attribute teilt sie sich offenbar auch mit Heinisch-Hosek und einigen anderen Frauen in SP) urteilt über Manager, die nicht "politisch gebildet" sind.
Menschen, vor allem aber Manager die
sparsam, anständig, gerecht, sozial-intelligent,
leistungsorientiert und integer
Warum?
Weil sie das übersteigerte Selbstbewußtsein von langdienenden Partei- und ÖGB-Funktionären, die in Regierungs- und Parlamentsfunktionen gehievt wurden, erheblich stören könnten!
Es reicht doch, wenn diese "Profi"-Politiker schon sehr enerviert sind, weil - völlig zu Recht - an den ohnenhin wackeligen Basisgerüsten ihrer (Ohn-)Macht heftig gerüttelt wird.
So betrachtet ist es eher eine Auszeichnung, wenn man als Politiker nicht geeignet ist!
2014-12-21  |
Doris Bures - das Orakel der SPÖ? |
2. orakelten die Priesterinnen unter dem Einfluss bewußtseinserweiternder Substanzen
3. wurden Priesterinnen später nur mehr aus dem Kreis betagter Frauen gewählt.
Auf Frau Bures trifft 1. mit Sicherheit nicht zu, 3. wäre uncharmant.
Die Frage nach bewußtseinsverändernden Substanzen stellt sich angesichts vieler Aussagen und Entscheidungen von Frau Bures zwar, ist aber zu verneinen, da sie eine gesetzestreue Bürgerin ist.
Vielmehr scheint sie ein Naturtalent zu sein, was die seltsame Wahrnehmung der Realität betrifft -
hier einige Beispiele, die diese Hypothese stützen:
- das Amt der Natinalratspräsidentin sei überparteilich und fair auszuüben,
dennoch ist persönliche und politische Beziehungspflege (was immer das meinen mag) kein Nachteil
- 882.184 = eine Million Menschen (die für das Steuermodell des ÖGB unterschrieben haben)
- Gute Manager "können Politik nicht", weil die Politik kein Unternehmen ist, das man führt
damit scheint sie - zumindestens in Österreich recht zu haben - hätte man die
Hypo-"Verstaatlichung" unternehmerisch durchgeführt, wäre uns das Desaster erspart geblieben.
Die Bayern haben sich unternehmerisch vorbereitet und Pröll & Co. über den Tisch gezogen!
Allerdings haben sich SPÖ-Politiker Streicher, Klima, Vranitzky, ..., - auch vormals Manager -
in der Politik nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert ¹)
- sie tat, was sie konnte - z.B. um teures Geld Tunnel vorantreiben, die keiner wirklich braucht
- sie tut, was sie kann! - was kann sie?
Seien wir also froh, eine derart kompetente, bescheidene, überparteiliche Nationalratspräsidentin zu haben!
Ob eine wirklich starke Frau und hervorragende Politikerin wie Barbara Prammer
mit ihrer Nachfolgerin zufieden wäre, können Sie selbst beantworten -
ohne ein Orakel befragen zu müssen!
¹) Zur Erinnerung:
Es war der "Sozi im Nadelstreif" der die Talfahrt der SPÖ einleitete.
Die Steyr-Motoren-"Privatisierung" von Streicher kostet viele Arbeitsplätze
und war in Zeiten der Hochkonjunktur wirtschaftlich unsinnig.
Dass in den Hochkonjunktur-Zeiten der Schuldenstand AUFgebaut wurde,
ist ebenfalls nicht als wirtschaftliche Meisterleistung zu bezeichnen.
2014-11-30  |
10 Millionen in die Luft gejagt Stoppt den Irrsinn! |
-->
1789 erklärte die Nationalversammlung in Paris die Menschenrechte. In Artikel 4 heißt es: »Die Freiheit besteht darin, dass man all das tun kann, was einem andern nicht schadet.«
Böllerei
600 Menschen verletzen sich jedes Jahr durch Knallkörper so schwer, dasa sie im Spital landen.
Die linke Hand von Andreas Schicker musste amputiert werden.
Beim Böller-Bau in die Luft geflogen 10 Millionen in die Luft gejagt Wer mit illegalen Böllern erwischt wird, muss bis zu 3600 Euro Strafe zahlen,
für Handel sogar bis zu 10.000 Euro.
bei Verstoss gegen Allergenauszeichnung bis zu 50.000.-
den Dreck EU-weit verbieten und das viele Geld, das da unnütz in die Luft gejagt wird -
und mit dem viele Menschen und Tiere völlig unnötig lärm-terrorisiert werden - für sinnvollere Dinge einsetzen.
Bei 77 Testkäufen in Baumärkten, bei Diskontern und im Internet wurden in 25 Fällen die Böller an Kinder und Jugendliche verkauft. Teilweise waren diese sogar nur elf Jahre alt.
Das ist das Ergebnis eines Mystery-Shopping-Versuchs des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Im Fachhandel bekamen die elfjährigen Kinder sogar zu 60 Prozent die gewünschten Kracher.Ab 4. Juli 2013 ist der Verkauf von Knallartikeln verboten. Ab Juli 2017 darf man Schweizer Kracher weder besitzen noch zünden. Das besagt das Pyrotechnik-Gesetz aus dem Jahr 2010.
2014-11-30  |
Aus für Plastiksackerln und was ist mit Plastikverpackungen? |
1789-08-26  |
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte - Frankreich 1789 |
--> Quelle: wikipedia
Am 26. August�1789�verk�ndete die franz�sische Nationalversammlung die�Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte�(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). Dies ist einer der Grundlagentexte, mit denen die Demokratie�und�Freiheit�in�Frankreich�begr�ndet wurden. Die Erkl�rung ist vom Gedankengut der�Aufklärung�gepr�gt.
Die�Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte�enth�lt eine Pr�ambel und 17 Artikel, welche die grundlegendsten Bestimmungen �ber den Menschen, seine Rechte und die Nation festschreiben. Sie erkl�rt, dass es�natürliche und unveräußerliche Rechte�wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdr�ckung geben muss. Alle Menschen m�ssen als gleich gelten, besonders vor dem Gesetz und dem Recht. Sie schlie�t auch die durch den�Freimaurer�und Staatstheoretiker�Montesquieu�in seinem Buch�Vom Geist der Gesetze�geforderte demokratische�Gewaltenteilung�ein. Wie �hnliche Texte galt auch die Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte zum Zeitpunkt ihrer Formulierung vor allem bez�glich der politischen Rechte nicht f�r die Frauen.�Olympe de Gouges�forderte�1791�die volle rechtliche, politische und sozialeGleichstellung�aller Geschlechter mit ihrer�Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin�ein.
Die�Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte�wird auch in der Pr�ambel zur�Französischen Verfassung�des4. Oktober�1958�zitiert, was beweist, dass sie bis zur heutigen�Fünften Republik�ihre Bedeutung, und zwar auch als Teil der franz�sischen Verfassung, nicht verloren hat. Sie ist die erste Menschenrechtserkl�rung in Europa.Präambel
�Les repr�sentants du peuple fran�ais, constitu�s en Assembl�e nationale, consid�rant que l’ignorance, l’oubli ou le m�pris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r�solu d’exposer, dans une d�claration solennelle, les droits naturels, inali�nables et sacr�s de l’homme, afin que cette d�claration, constamment pr�sente � tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs�; afin que les actes du pouvoir l�gislatif et ceux du pouvoir ex�cutif, pouvant �tre � chaque instant compar�s avec le but de toute institution politique, en soient plus respect�s�; afin que les r�clamations des citoyens, fond�es d�sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.�
�En cons�quence, l’Assembl�e nationale reconna�t et d�clare, en pr�sence et sous les auspices de l’�tre Supr�me, les droits suivants de l’homme et du citoyen.�
„Die Vertreter des französischen Volkes, als Nationalversammlung�konstituiert, haben unter der Ber�cksichtigung, dass die Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des �ffentlichen Ungl�cks und der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, die nat�rlichen, unver�u�erlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erkl�rung darzulegen, damit diese Erkl�rung allen Mitgliedern der Gesellschaft best�ndig vor Augen ist und sie unabl�ssig an ihre Rechte und Pflichten erinnert; damit die Handlungen der�Legislative�und jene der�Exekutive�in jedem Augenblick mit dem Ziel jeder politischen Einrichtung verglichen werden k�nnen und dadurch mehr respektiert werden; damit die Anspr�che der B�rger, fortan auf einfache und unbestreitbare Grunds�tze begr�ndet, sich immer auf die Erhaltung der Verfassung und das Allgemeinwohl richten m�gen.“
„Dementsprechend anerkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutze des höchsten Wesens�folgende Menschen- und B�rgerrechte.“
Artikel 1
„Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.“
Die Menschen (Männer[3]) werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.Artikel 2
„Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.“
Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung.Artikel 3
„Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.“
Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht.Artikel 4
„La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.“
Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet: Die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss ebendieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden.Artikel 5
„La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.“
Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert werden, und niemand kann gezwungen werden zu tun, was es nicht befiehlt.Artikel 6
„La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.“
Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. Es muss für alle gleich sein, mag es beschützen oder bestrafen. Da alle Bürger vor ihm gleich sind, sind sie alle gleichermaßen, ihren Fähigkeiten entsprechend und ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Eigenschaften und Begabungen, zu allen öffentlichen Würden, Ämtern und Stellungen zugelassen.Artikel 7
„Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.“
Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangengehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und nur in den von ihm vorgeschriebenen Formen. Wer willkürliche Anordnungen verlangt, erlässt, ausführt oder ausführen lässt, muss bestraft werden; aber jeder Bürger, der kraft Gesetzes vorgeladen oder festgenommen wird, muss sofort gehorchen; durch Widerstand macht er sich strafbar.Artikel 8
„La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.“
Das Gesetz soll nur Strafen festsetzen, die unbedingt und offenbar notwendig sind, und niemand darf anders als aufgrund eines Gesetzes bestraft werden, das vor Begehung der Straftat beschlossen, verkündet und rechtmäßig angewandt wurde.Artikel 9
„Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.“
Da jeder solange als unschuldig anzusehen ist, bis er für schuldig befunden wurde, muss, sollte seine Verhaftung für unumgänglich gehalten werden, jede Härte, die nicht für die Sicherstellung seiner Person notwendig ist, vom Gesetz streng unterbunden werden.Artikel 10
„Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.“
Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerung nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört.Artikel 11
„La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.“
Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte: Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen.Artikel 12
„La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.“
Die Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte erfordert eine öffentliche Gewalt; diese Gewalt ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht zum besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist.Artikel 13
„Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.“
Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für die Verwaltungsausgaben ist eine allgemeine Abgabe unerlässlich; sie muss auf alle Bürger, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten, gleichmäßig verteilt werden.Artikel 14
„Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.“
Alle Bürger haben das Recht, selbst oder durch ihre Vertreter die Notwendigkeit der öffentlichen Abgabe festzustellen, diese frei zu bewilligen, ihre Verwendung zu überwachen und ihre Höhe, Veranlagung, Eintreibung und Dauer zu bestimmen.Artikel 15
„La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.“
Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem Staatsbeamten Rechenschaft über seine Amtsführung zu verlangen.Artikel 16
„Toute société dans laquelle la garantie des droits n¹est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution.“
Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung.Artikel 17
„Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité“.
Da das Eigentum ein unverletzliches und geheiligtes Recht ist, kann es niemandem genommen werden, es sei denn, dass die gesetzlich festgestellte öffentliche Notwendigkeit dies eindeutig erfordert und vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt wird.1948-12-10  |
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 |
-->
| [deutsche Übersetzung] | [englisches Original] |
| Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 | |
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte |
Universal Declaration of Human Rights |
Präambel
|
Preamble
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artikel 1
|
Article 1
|
Artikel 2
|
Article 2
|
|
|
Artikel 3
|
Article 3
|
Artikel 4
|
Article 4
|
Artikel 5
|
Article 5
|
Artikel 6
|
Article 6
|
Artikel 7
|
Article 7
|
Artikel 8
|
Article 8
|
Artikel 9
|
Article 9
|
Artikel 10
|
Article 10
|
Artikel 11
|
Article 11
|
Artikel 12
|
Article 12
|
Artikel 13
|
Article 13
|
Artikel 14
|
Article 14
|
Artikel 15
|
Article 15
|
Artikel 16
|
Article 16
|
Artikel 17
|
Article 17
|
Artikel 18
|
Article 18
|
Artikel 19
|
Article 19
|
Artikel 20
|
Article 20
|
Artikel 21
|
Article 21
|
Artikel 22
|
Article 22
|
Artikel 23
|
Article 23
|
Artikel 24
|
Article 24
|
Artikel 25
|
Article 25
|
Artikel 26
|
Article 26
|
Artikel 27
|
Article 27
|
Artikel 28
|
Article 28
|
Artikel 29
|
Article 29
|
Artikel 30
|
Article 30
|
2014-11-30  |
Die Oral_B Zahnbürste, Procter & Gamble und das P&G - "Umsatzsteigerungsprogramm" |
Seit geraumer Zeit will sie nun jeden zweiten Tag aufgeladen werden - nun ja, Akkus können schon mal altern und ihre Leistung verlieren.
Richtig alt sieht man aber aus, wenn man diesen Akku tauschen will.
Hier der Weg zum "Umsatzsteigerungsprogramm" von Procter und Gamble:
Firma Braun = P&G läßt dies nicht zu!
Gerätetausch nicht möglich - "Die ist ja schon 4Jahre alt!"
Angebot Neugerät: € 199,80 !
- Ersatzakku-Suche im Internet - Resultat: € 8,90
- Eigeneinbau scheitert an Spezialverschluss, "Servicepartner" können, dürfen, wollen nicht öffnen!
- Spezialwerkzeug darf nicht verkauft, geschweige den weitergegeben werden!
- Akku-Tausch Angebot im Internet: 23,90 incl. Akku und Ladestation-Test!
Fazit:
Deutsches Austauschangebot genutzt - schlappe € 171,- gespart!
Umsatzsteuer nach Luxemburg - danke Jean Claude - exportiert (weil Amazon)
Umwelt geschont - weil Altgerät nicht "JUHU!" (© T_Mobiile) wegeworfen!
Dem Umsatzgeier P&G eine lange Nase gedreht!
Suchen auch Sie nach Alternativen, bevor Sie "JUHU!" wegschmeissen,
Sie sparen und schonen die Umwelt!
Reparieren statt verschwenden! akkutauschen.de
2014-11-23  |
Schwarz und Rot - hört auf Erzengel Gabriel |
„Es muss doch endlich mal Schluss damit sein,
dass wir den kleinen und mittleren Unternehmen die Steuern erhöhen,
während die ganz großen sich davor drücken können“, sagt Gabriel.
2014-11-22  |
Salomonische Moralapostel |
Kommentar in Arbeit

2014-11-22  |
Richtige Eliten? |

Wir brauchen Eliten – aber richtige Eliten  Helmut Brandstätter - KURIER 2014-11-22
Helmut Brandstätter - KURIER 2014-11-22
Die Gesellschaft zerfällt.
Das liegt an der ungleichen Verteilung von Vermögen, aber nicht nur daran.
2014-11-21  |
Denkverbote und Fracking? |
Österreich gilt seltsamerweise als liberales Land.
In Wahrheit wird die Liste der Tabus täglich länger.
Kommentar in Arbeit
 :
:Nicht die Technik oder die Ideologie ist das Problem - die ausführenden Menschen sind es!
Der Untergang der Deepwater Horizon war kein technisches Problem. Die Manager, die all die schönen - technischen - Sicherheitsvorrichtungen einfach über Bord kippten. Weil es zu teuer war. Und niemand der Verantwortlichen ernsthafte Konsequenzen tragen musste. Auch Fukushima zeigte deutlich, das die durch die Natur ausgelöste Katastrophe durch inkompetente Manager zum Desaster wurde. Die Amerikaner beweisen ....
2014-10-31  |
Heinisch-Hosek und der Karottenkönig |
Wer wird Karottenkönig?
... in einem Kindergarten wird derjenige „Karottenkönig“,
der am schnellsten Kondome über eine Karotte ziehen kann!
So berichtet zumindest das schweizerische "Klagemauer.tv".
In der Schweiz (Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule Schweizer Initiative vor Frühsexualisierung) und auch in Deutschland treten besorgte Eltern gegen den Frühsexualisierungszwang für Kinder an (Demo in Frankfurt a. M.: Kein Frühsexualisierungszwang für unsere Kinder - 21.06.2014).
Die Auswüchse der Sexualerziehung - bereits ab dem Kindergarten - haben zu diesem Widerstand geführt.
Offenbar sind die Verantwortlichen weit über das - berechtige - Anliegen altersadäquater Aufklärung hinausgeschossen (mehr dazu: Frühsexualisierung) und haben damit die Ablehnung der "Sexualerziehnung" - i.B. durch Institutionen - hervorgerufen.
 So gibt die Kuriermeldung
"Heinisch-Hosek: Sex-Erziehung im Kindergarten" von Christian Böhmer Anlaß zu erheblicher Sorge.
So gibt die Kuriermeldung
"Heinisch-Hosek: Sex-Erziehung im Kindergarten" von Christian Böhmer Anlaß zu erheblicher Sorge.
Die Ergebnisse des 8. Frauenbarometers geben ihr augenscheinlich recht. 48% der Befragten meinen, dass die Sexualerziehung müsse im Kindergarten oder in der Volksschule, jedenfalls aber spätestens im Alter von zehn Jahren (41% Zustimmung) einsetzen soll.
Viele Erwachsene, aber auch Kindergartenpädagogen und Lehrer sind heute immer noch überfordert, wenn sexualpädagogische Fragen altersadäquat beantwortet werden sollen.
Betrachtet man die Erfolge unseres Bildungssystems, jagt einem die Vorstellung einer
heinisch-hosek'schen Sexualerziehung eiskalte Schauer über den Rücken!
2014-10-31  |
"Neusprech" moralisiert und verschleiert! |
Wie man mit "Neusprech" moralisiert und verschleiert
Sprache wurde immer für Ideologie benutzt – und sagt viel über den Zustand einer Gesellschaft aus.
Hierzulande lassen sich zunehmende Verpädagogisierungs- und Verschleierungstendenzen in der Sprache beobachten. Die Betulichkeitsindustrie hat Spuren hinterlassen – und die Pirouetten, die wir schlagen, um Frauen oder andere Ethnien nicht zu diskriminieren, nehmen manchmal durchaus lächerliche Formen an.
So ist es zwar wirklich vernünftig, nicht nur über "Chefs" zu reden und zu schreiben, um nicht das Klischee reiner Männerriegen weiter zu verfestigen. Aber wenn fortschrittliche Menschen (besonders auf diversen Bildungs-)Podiumsdiskussionen unentwegt das Binnen-I verlautlichen und damit nur mehr die weibliche Form verwenden, ist in der Sprache auch der Wurm drin.
Das Normungsinstitut Austrian Standards hat sich übrigens diese Woche nach überaus heftigen Debatten entschlossen, keine Empfehlung für das Binnen-I herauszugeben. Geschlechtssensible Sprache ist kein Fall für die Önorm. Darüber darf man erleichtert sein.
Die Neos hingegen schwimmen auf dieser Welle ganz vorne mit. Sie luden am Donnerstag zur Konferenz über "Geschlechterdemokratisierung in liberalen Parteien". Unübertroffen im Gleichstellungs-Quacksprech ist allerdings die Hochschülerschaft an der Uni Wien. Dort ist man auch Meister des Unterstrichs: Student_innen! Damit werden beide Geschlechter gleichberechtigt angesprochen. Binnen-I gilt in solchen Kreisen als frauenfeindliches Phallus-Symbol – kein Scherz. Interessanterweise bietet die ÖH in ihrem Newsletter (wörtlich) auch Folgendes an: "kostenlose Workshops und Fortbildungen für Frauen* und trans*identifizierte Menschen". Die Männer sind irgendwie verloren gegangen, obwohl in der ÖH "partizipiert" wird, was das Zeug hält.
Die Wirtschaft wiederum gibt sich mit neuen Bezeichnungen progressiv: Facility Manager statt Hausverwalter, Assistent statt Sekretär, CEO statt Vorstand (bitte um Nachsicht: die männliche Form gilt in dieser Kolumne für beide Geschlechter). "Weiße Elefanten" werden mit bombastischen Bezeichnungen aufgewertet: Sie sind dann Sonderbeauftragte oder "Senior Advisor to the Board". Natürlich werden Leute nicht gekündigt, sondern "freigesetzt". Es wird sozusagen "Humankapital optimiert". Gleichzeitig müssen Manager – Abteilungsleiter gibt es ja nicht mehr – auf den USP (unique selling proposition, also Einmaligkeit) der Firma und die Awareness (Aufmerksamkeitswert) ihres Produkts achten. Also alles keine leichten Aufgaben.
Die Politik hat aus der Notstandshilfe eine Mindestsicherung gemacht – und damit das Image aufgemöbelt. Wenn Politiker eine "Vermögenssteuer" fordern, dann soll das so klingen, als wären nur wirklich Reiche betroffen. AK-SPÖ-ÖGB ertränken mittlerweile jedes Thema in einer "Gerechtigkeits"-Soße – von Generationen- über Gender- bis zur Klimagerechtigkeit. Was in der Regel bedeutet, dass dafür mehr Geld im Budget lockerzumachen ist.
Und was sagen Regierungsparteien zur nun aufgeflogenen Wahlkampfkostenüberschreitung? "Es gibt sicher Bedarf, das Gesetz zu evaluieren." Bedeutet übersetzt: "Rutscht uns den Buckel runter." Man muss eben immer "situationselastisch" reagieren.
2014-10-18  |
Schneewittchenfieber, das Märchen vom "Retroweibchen" |
Steht eine Rückkehr des Hausmütterchens bevor?
Die, lt. Frau Salomon "fabelhafte", Journalistin Angelika Hager hat als "68erIn" ihre BH's verbrannt, um dem Feminismus zum Sieg zu verhelfen.
Offenbar leitet Sie daraus das Recht ab, junge Frauen, die sich der EU-Falle Frauenvollbeschäftigung entziehen, zu verunglimpfen und als Verräterinnen und "Retroweibchen" zu diskreditieren.
Auch Frau Hager wird wohl das spektakulärste Ergebnis des "Jugendmonitor":
Mehr als die Hälfte der befragten Mädchen und Frauen zwischen 14 und 24 Jahren
können sich vorstellen, der Familie zuliebe auf eine Karriere zu verzichten.
55 Prozent bejahten die Aussage: „Wenn mein Partner so viel verdient,
dass unser Lebensunterhalt gesichert ist, möchte ich Hausfrau sein.“
zur Kenntnis nehmen müssen.
Ihre Frage:
"Und wann und warum genau ist eigentlich der Feminismus dermaßen auf die Schnauze gefallen?"
ist rasch und einfach zu beantworten:
Seit sich die selbsternannten und selbstgefälligen Handlangerinnen der EU-Wirtschaft
mehr um Binnen-I und Quotenfrauen in Aufsichtsräten stark machen, anstatt
leistungsgerechte Entlohnung und attraktive Arbeitsplätze für Frauen durchzusetzen!
Seit die jahrzehntelange, feministische Gehirnwäsche dazu führt,
dass es Mut braucht, um sich zu Kindern zu bekennen.
Seit Frauen zu dauererschöpften, unterbezahlten und "emanzipierten" Müttern gemacht wurden.
Seit amerikanische Firmen Arbeitnehmerinnen offenbar das Einfrieren der Eizellen bezahlen.
......
Dass der Kinderwunsch sehr stark ausgeprägt ist (55 Prozent der befragten Frauen und 36 Prozent der befragten Männer wollen auf jeden Fall einmal Kinder haben. die Mehrheit, nämlich 62 Prozent, will zwei Kinder) und dass 77% Prozent sind der Meinung sind: Kinder bis drei Jahre sollten hauptsächlich von den Eltern zu Hause betreut werden, sind ebenfalls Resultate, die Frau Hager wohl nicht so recht in den Kram passen werden.
Frau Angelika Hager - die laut eigener Aussage als "Teilzeit-Erzieherin" nicht wirklich toll erfolgreich war (wohl weil berufliche Unabhängigkeit und Freiheit wichtiger als "Brutpflege waren) - sollte sich m. E. lieber ihrer exaltierten "Polly Adler" widmen und ihr endlich einen passenden Partner zugestehen, statt zu versuchen mit Märchen aus "Großmutters Mottenkiste" Kohle zu machen und junge, selbstbestimmte Menschen zu desavouieren.
P.S.: Wäre da nicht der Kinderreichtum, der sich im Wesentlichen auf Migrantenfamilien aus
ländlich-frommen Regionen, Adelige und sozial Unterprivilegierte konzentriert (© Martina Salomon),
dann wäre unser Sozialsystem noch schlechter dran, als es ohnedies schon ist!
Ist Feminisumus out?, Jede zweite junge Frau waere gerne Hausfrau
2014-10-16  |
Schafft die ÖIAG, das BIFIE und ähnlich sinnlose und teure Konstrukte ab! |
Er sieht die "Staatsholding" als Privatisierungsagentur,
die jämmerlich versagt hat und hat damit nicht so unrecht.
Die Verschleuderung der Austria Tabak führte zur Stilllegung der Produktion in Österreich und damit zum Verlust von hunderten Arbeitsplätzen, das Verschenken der AUA mit einem "Sahnehäubchen" von 100,000.000 € und auch die Aufgabe der Mehrheitsbeteiligung an der Dividenden-Melkkuh TELEKOM sind schlimme Beispiele für das Versagen der OIAG - auch als "Privatisierungsagentur"!
Das Ministerium ist lt. Duden die höchste Verwaltungsbehörde eines Landes mit einem bestimmten Aufgabenbereich. Somit ist der Vorschlag Hebenstreits, "die OMV wäre mit der Energieversorgung im Wirtschaftsministerium gut aufgehoben. Für die Infrastrukturbetriebe Post, Telekom, Asfinag und ÖBB wäre eine Konzentration im Verkehrsministerium sinnvoll."
Recht hat er. Und viel schlechter als die mäßig Begabten der Staatsholding können es die Ministerien auch nicht machen. Außerdem könnte man bei einer Auflösung de ÖIAG wahrscheinlich dreistellige Millionenbeträge einsparen und diese notleidenden Ministerien (Bildung, Heer, ...) zuführen.
Vielleicht hören Schelling und Mitterlehner zu und verhindern, dass systemrelevante Infrastrukturunternehmen von einer - neuerlich aufgeblähten (ÖIAG mit zwei Teil-Gesellschaften unter einer Bundesbeteiligungs-Holding !?!) - "dividendengeilen" Gesellschaft gesteuert werden, deren bisherigen Manager agieren wie WU-Studenten im 2. Semeseter.
Allerding müssten dann Mitterlehner und Schelling die Ohren vor dem Winseln bisheriger und auch in Aussicht genommer Pfründner verschließen!
P.S.: Wie wär's mit einer Auflösung des BIFIE, da könnte Frau Minister auch ein paar Millönchen einsparen! Oder sind die inss BIFIE ausgelagerten Aufgaben nicht ursächliche Agenden des Ministeriums?
2014-10-11  |
Die gesenkten Köpfe Europas sind Ausdruck einer orientierungslosen Gesellschaft |
Sowohl beim Autor, als auch beim Kurier, bitte ich um Vergebung wegen einer möglichen Verletzung des ©, hoffe aber, dass dieser Artikel so wichtig ist, dass er einer weiteren Leserschaft zugänglich gemacht werden sollte.
Mit gesenktem Kopf
Warum wir alle einmal aufblicken sollten, statt mit gesenktem Kopf gegen Wände zu laufen, alles hinzunehmen oder gar den Kopf zu verlieren.
Kürzlich beobachtete ich einen jungen Mann, der mit gesenktem Kopf auf sein Mobiltelefon blickend gegen ein Verkehrsschild lief und gleich drauf verdutzt am Boden saß. Wir alle haben uns schon über Autofahrer geärgert, die lebensgefährliche Fahrweisen hinlegen, weil sie ganz offensichtlich nach unten aufs Handy statt nach vorne auf den Verkehr sehen.
In öffentlichen Verkehrsmitteln sehen wir die vielen vornüber Gebeugten, die auf Tablets oder ganz ins Leere starren, die ihre unmittelbare Umwelt ignorieren und mit oder ohne Drogen in „anderen Sphären schweben“. Wenn das nur die Einzigen wären.
Wir kennen aber auch Führungskräfte, die beim Meeting den Kopf so halten, dass sie auf das knapp unterhalb ihrer Tischkante befindliche Kommunikationsgerät blicken, statt ihren Gesprächspartnern in die Augen zu sehen. Sie hören nicht zu, weil sie „schnell mal“ ihre Mails checken. Sie erheben sich auch manchmal, um sich eine Zeit lang zu entfernen. Sie bringen damit ganz klar ihre Missachtung der anderen Anwesenden und dem Meeting-Thema gegenüber zum Ausdruck.
Im Fernsehen und bei Events senken nicht selten Politiker und Manager bei Ansprachen leicht den Kopf bzw. den Blick, um auf eine Vorlage zu sehen, die ihnen all die Stichworte liefert, die sie offenbar nicht ausreichend parat haben.
Demgegenüber erduldet die Mehrheit der Menschen der westlichen Welt mit gesenktem Kopf und tatenlos die Fehlentwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Erschütterndes Bild: Mit gesenktem Kopf kniet ein Mensch aus der westlichen Welt vor seinem terroristischen Scharfrichter, der ihn schließlich enthauptet.
Ambitionslos
Ich sehe dieses zunehmende Kopfsenken, Wegtauchen und Ausweichen in der westlichen Gesellschaft als eine unbewusste
Geste der Wehrlosigkeit, Angst, Unterwerfung und der Dekadenz.
Die gesenkten Köpfe Europas sind Ausdruck einer
orientierungslosen, realitätsverweigernden, ambitionslosen Gesellschaft, die sich dem Schicksal ausgeliefert fühlt.
Eine Gesellschaft, die dort ist, wo sie unverantwortliche Mächtige gerne haben wollen:
In der Position der Duckmäuser, Jasager, der entmündigten Konsumenten und des Stimmviehs.
Natürlich ist dies kein Plädoyer gegen die Nutzung moderner Kommunikationgeräte, sondern
für den Blick nach vorne, den aufrechten Gang und ein selbstbestimmtes Leben.
Dafür, endlich wieder das Wichtige vor dem Dringenden zu tun.
Der kreative, bildungsfreudige und unternehmungslustige Mittelstand hat die große Chance, hier voranzugehen.
Mit Hinsehen statt Wegschauen, Nachdenken statt Grübeln, Teilhabe statt Apathie, Erneuerung statt Wiederholung.
Für ein innovatives und demokratisches Global-Zukunftsmodell.
Also: Kopf hoch, Europa!
Nicht nur Europa, sondern jeder Einzelne von uns sollte diesem Appell folgen!
Weitere lesenswerte Kommentare von Wolfgang Lusak.
2014-10-12  |
Der steirische Brauch - ein Rezept für Östereich? |
Josef Votzi schreibt im Kurier vom 2014-10-12
Politik braucht mehr Schellings und Voves
Politik braucht mehr Schellings und Voves
Der steirische Erfolgsweg beweist:
Wer nicht von Applaus und Ämtern leben muss, macht bessere Politik.
Wer sich mit Politikern zeigt, macht die Erfahrung: Oft wird wenig Schmeichelhaftes getuschelt; immer öfter offen gemurrt; mehr als höflicher Applaus kommt selten auf. Es war daher außergewöhnlich, was sich dieser Tage in einem Lokal in der Wiener Innenstadt zutrug.
Der KURIER traf den steirischen Landeshauptmann zum Interview. Das Gespräch musste mehrmals unterbrochen werden, weil spontan Gäste an den Tisch kamen: Gratulation dazu, wie ihr in der Steiermark das macht, Herr Voves. Schade, dass das nicht überall so ist
Was machen die Steirer anders, dass sie auch im fernen Wien Ovationen auslösen? SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves und der steirische ÖVP-Chef und Landesvize Hermann Schützenhöfer zogen in den vergangenen vier Jahren ein Reformprogramm durch, das sich sehen lassen kann: Zusammenlegung von fast dreihundert Kleingemeinden, Straffung von Bezirksgrenzen, Schließung überzähliger Spitalsabteilungen und Einschnitte bei Sozialleistungen.
Vieles von dem also, was im Bund bisher nur gepredigt wurde:
Verwaltungseinsparungen und Bändigung von Kostentreibern.
Ohne Notbremsung stünden die Steirer mit vier Milliarden neuen Schulden da.
2015 gibt es so nun erstmals wieder ein Budget ohne Neuverschuldung.
Rotes Lob für Schwarze ohne Widerhaken
Der Bund hat diesen politischen Kraftakt noch vor sich.
Die erste Frage, die Finanzminister Hansjörg Schelling bei seinem Besuch diese Woche in der Steiermark stellte, war denn auch:
Wie habt ihr das gemacht, dass vier Jahre gearbeitet und nicht gestritten wurde?
Die meisten anderen Spitzenpolitiker im Bund reagieren meist unangenehm berührt, wenn Ihnen die Steirer als Vorbild angepriesen werden. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie auf eine Ingredienz des erfolgreichen steirischen Reformrezepts nicht gerne angesprochen werden wollen.
Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer hielt erfolgreich die Tradition hoch, einen von der Bundes-ÖVP weitgehend unabhängigen und konsequent eigenständigen politischen Kurs zu fahren.
SPÖ-Chef Franz Voves war vor seinem Umstieg in die Politik 13 Jahre erfolgreicher Manager in der Privatwirtschaft. Der Quereinsteiger war materiell nie allein von der Politik abhängig.
Dank der weit über die Steiermark respektierten rot-schwarzen Reformagenda kann er sich leisten, die üblichen Usancen der Parteipolitik auch heute noch zu ignorieren.
Der rote steirische Landeschef setzt seine größten Hoffnungen in Wien keck in das neue schwarze Spitzenduo in Finanzministerium und Partei: "Mit Schelling und Mitterlehner kann die ÖVP wirklich einen Neustart zuwege bringen. Schelling ist absolut ein Gewinn für die Regierung. Jeder, der nicht materiell abhängig von der Politik ist, ist ein Gewinn, ist eine Chance für richtige, wichtige sachbezogene Politik".
So viel Vorschuss-Vertrauen über Parteigrenzen hinweg ist nicht nur einmalig.
Es macht auch plastisch, warum der steirische Weg erfolgreich und nachahmenswert ist. "Schelling ist absolut ein Gewinn für die Politik"
Franz Voves im Interview.
Bei der Landtagswahl 2015 tritt er zum dritten Mal als SPÖ-Spitzenkandidat an.
Josef Votzi Kurier2014-10-12
Ida Metzger
Kurier Interview 2014-10-07
Die Entscheidung vor zehn Tagen wurde weit über die Steiermark mit Spannung erwartet: Der steirische Landeshauptmann, Franz Voves, tritt noch einmal als SPÖ-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2015 an. Die Reformpartnerschaft mit ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer, die harte Einsparmaßnahmen durchsetzte, gilt als Vorzeigemodell für ganz Österreich. Im großen KURIER-Interview erklärt er, wie das funktionieren konnte, nimmt die Regierung in Wien ins Visier, lobt aber den Neustart der ÖVP mit Mitterlehner und Schelling.
KURIER: Herr Voves, Sie werden bei der Wahl im Herbst 2015 noch einmal als SPÖ-Spitzenkandidat ins Rennen gehen. 38 Prozent wie bei der letzten Wahl wird es wohl nicht mehr geben. Wegen der schmerzhaften Reformen drohen markante Verluste für Rot und Schwarz. Warum tun Sie sich die Abstrafung durch den Wähler an?Franz Voves: Weil es meinem Charakter entspricht, für die vielen Veränderungen, die unsere Reformpartnerschaft ausgelöst hat, die Verantwortung zu übernehmen, indem ich mich dem Wählervotum stelle. Aber es war natürlich auch berührend, wenn man nach 12 Jahren als Parteivorsitzender bei einer geheimen Wahl mit hundert Prozent bestätigt wird.Warum haben Sie sich für die Entscheidung, ob Sie wieder antreten, so lange Zeit gelassen?Das war ein innerer Kampf. Im Sommer habe ich mir mehrmals die Frage gestellt: Will ich das wirklich nochmals? Kurz nach der Wahl werde ich 63 Jahre alt. Da überlegt man sich schon, habe ich die Kraft und vor allem die Leidenschaft, mich nochmals in die Wahlschlacht zu werfen. Denn nur der Partei zuliebe wäre zu wenig Motivation. Aber es war unglaublich, wie oft ich im Sommer von Menschen aus ganz Österreich angesprochen wurde – den Weg, den Hermann Schützenhofer und ich eingeschlagen haben, auch weiterzugehen. Bei solchen Begegnungen fühlt man sich sehr geehrt, wird aber auch nachdenklich.
Sie springen ohne Netz. Denn Hermann Schützenhofer, der nun vier Jahre mit Ihnen gemeinsam regierte, hat sich noch nicht entschieden?
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung und Hermann Schützenhofer ist noch nicht so weit. Vielleicht auch deswegen, weil in der steirischen ÖVP auch Andere Ambitionen haben, seine Funktion künftig einzunehmen (Anm. d. Red.: z.B. der Grazer Bürgermeister Nagl).Rot und Schwarz haben sich noch im Wahlkampf 2010 bis aufs Messer bekriegt. Wer machte nach der Wahl den ersten Schritt zur Versöhnung?Finanzminister Hans Jörg Schelling hat uns diese Woche die gleiche Frage gestellt. Wir haben es gemeinsam geschafft, einen großen Schlussstrich unter fünf Jahre Streit zu ziehen. Nachdem Hermann und ich uns neu gefunden haben, wurde das gesamte Ritual verändert. Es gab keine wöchentlichen Pressekonferenzen mehr. Und ganz wichtig: Wir sind mit Reformen erst an die Öffentlichkeit getreten, nachdem wir hinter dem Vorhang ordentlich gestritten hatten, aber letztlich den Kompromiss gut kommuniziert haben. Also ganz anders als es bis dato in der Bundesregierung läuft. Denn hier regiert leider noch immer das Prinzip, dass man sich wichtige Haltungen über die Medien mitteilt. So kommt man nicht zu den richtigen, notwendigen Entscheidungen.Warum dieser radikale Kurswechsel?Wir hatten fünf Jahre lang einen erbitterten Kampf geführt. Aber letztendlich waren wir bei der Wahl beide Verlierer. Hätten wir diesen Stil so weiter fortgeführt, hätten wir die Steiermark an die Wand gefahren. Die SPÖ und die FPÖ hatten nach der letzten Wahl eine Mehrheit von einem Mandat. Ich habe zwar mit der FPÖ Gespräche geführt, aber sie war nie eine echte Option. Beim Gespräch mit Hermann Schützenhofer habe ich ihm auf den Kopf zugesagt: "Hermann, hör zu, übernehmen wir doch einfach Verantwortung für unser Land. Oder willst so weitermachen?" Darauf antwortete Schützenhofer etwas überrascht: "Heißt das, du willst nochmals mit uns koalieren, obwohl du mit der FPÖ eine Mehrheit hättest?" Meine Antwort war klar: "Ja, wenn wir in der Lage sind, einen ganz dicken Schlussstrich zu ziehen. Niemand zieht den anderen mehr über den Tisch – und wir sind als echte Partner unterwegs." Dann gab es einen Handschlag zwischen uns. Ab diesem Moment hat es unglaublich toll funktioniert. Die Wege zu unseren Kompromissen waren oft harte Arbeit. Aber die "Chemie" zwischen uns hat bis heute gestimmt.Bei der Nationalratswahl 2013 war die FPÖ in der Steiermark bereits Nummer 1. In allen Umfragen zur steirischen Landtagswahl sind Rot und Schwarz klar vorne. Was machen Sie besser als die Koalition in Wien?Weil einfach die "Chemie" bei den Führenden stimmt! Vielleicht ist es ein glücklicher Zufall, dass wir beide aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Ich bin ein Arbeitersohn aus der Puch-Siedlung in Graz. Der Vater vom Hermann war auch Arbeiter, gelebt hat die Familie in einem Pfarrhof. Zwei Männer, die ähnliche Herkunft und ähnlichen Hintergrund haben, die Handschlag leben und denen es gelungen ist, auch das ganze Team mitzunehmen. Inzwischen sind wir eine eingeschworene Truppe. Sie müssen sich vorstellen, das gab es noch nie, dass die SPÖ und die ÖVP Steiermark gemeinsame Klubsitzungen in den Räumen der ÖVP abgehalten haben. Das war einmalig, einzigartig und unglaublich wichtig für die Steiermark.Was war in den vier Jahren das für beide Partner schwierigste Reform-Projekt?Sehr sensibel war die Gemeindereform. Das war unheimlich viel Arbeit. Hermann Schützenhofer und ich haben Hunderte Gespräche geführt – von Drüberfahren kann da nicht die Rede sein. Der beste Beweis dafür, dass es ein hochdemokratischer Prozess war: Von 387 involvierten Gemeinden gab es in 308 Gemeinden freiwillige Gemeinderatsbeschlüsse für eine Fusionierung. Die Steiermark war von allen Bundesländern das Kleinstrukturierte. Wir haben jetzt noch 100 Gemeinden unter 500 Einwohner und 200 Gemeinden unter 1000 Einwohner. Hermann Schützenhöfer hatte einen wesentlich höheren Anteil an dieser Arbeit zu leisten.Wie wollen Sie bei so viel Harmonie einen Wahlkampf führen? Gibt es vielleicht ein gemeinsames Plakat "Lasst Voves und Schützenhofer arbeiten?"(lacht) Ich habe schon gesagt, ich werde keinen Wahlkampf gegen die ÖVP führen. Es wird ein kurzer und billiger Wahlkampf. 2010 haben wir noch viel versprochen, obwohl wir wussten, dass es nicht finanzierbar ist. Das war ein Fehler! Jetzt haben wir wieder finanzielle Handlungsspielräume geschaffen und SPÖ und ÖVP können einen "Wahlkampf der besseren Ideen" für 2015 bis 2020 führen.
Wie groß ist der Spielraum, wenn noch immer fünf Milliarden Euro Schulden da sind?Wir haben durch sehr restriktiven Budgetvollzug in den letzten Jahren so 400 bis 500 Millionen Euro bei einem Budget von fünf Milliarden geschaffen für künftige Investitionen. Deswegen können SPÖ und ÖVP sehr wohl einen sehr unterschiedlichen Wahlkampf führen.Trotz der Reformen war die FPÖ bei den letzten Nationalratswahlen Nummer 1 in der Steiermark. Wie sehr schmerzt das?Die Wähler unterscheiden genau zwischen Bundes- und Landeswahlen. Das war keine Watschen für die steirischen Reformer. Sie hatten nur einen geringen Anteil an diesem Wahlergebnis. Die bundesweite Grundstimmung vor allem in den steirischen Industriezonen ist vielmehr so: "Die zwei Großparteien in Wien tun nichts mehr für uns." Deswegen habe ich schon vor einigen Jahren eine Entlastung des Faktors Arbeit über eine Steuerreform verlangt.Finanzminister Hans-Jörg Schelling war diese Woche bei Ihnen in der Steiermark. Welche Tipps haben Sie ihm auf den Weg gegeben?Mit Schelling und Mitterlehner kann die ÖVP wirklich einen Neustart zuwege bringen. Meine persönliche Ansicht hat sich nach dem Gespräch bestätigt. Schelling analysiert jetzt genau, erarbeitet klare Konzepte und wird dann zu allen Beteiligten sagen: "So machen wir das jetzt. Macht ihr mit? Und wenn ein Nein kommt, wird Schelling antworten: "Ihr macht nicht mit? Dann machen wir es trotzdem." Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird, und ich habe ihn dazu auch motiviert.Schelling ist ein Gewinn für die Regierung?Schelling ist absolut ein Gewinn für die Regierung. Jeder, der nicht materiell abhängig von der Politik ist, ist ein Gewinn, ist eine Chance für richtige, wichtige sachbezogene Politik.Braucht auch die SPÖ mehr Schellings?Da sind wir bei der grundsätzlichen Frage, wie gelingt es uns die Qualität in der Politik wieder zu stärken. Wenn wir uns darauf reduzieren, dass die Abgeordneten und Minister nur mehr aus zwei Berufsgruppen kommen, dann ist das nicht gesund. Wir haben am 15. November einen Reformparteitag in der Steiermark und werden die Öffnung der steirischen SPÖ beschließen. Neben der Stammorganisation wird es auch eine Zielgruppenorganisation geben, wo wir ganz gezielt Menschen einladen werden, ihr Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten sowie ihre Leidenschaft der Politik zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen auch Parteilosen, die mit unseren Grundwerten übereinstimmen, Mandate im Landtag bzw. Gemeinderat geben.Wie viele Mandate wollen Sie für Parteilose in der SPÖ freischaufeln?Wenn man 23 Mandate im Landtag hat, dann kann es drei bis vier Mandate durchaus für Parteilose geben. Dazu gibt es schon einstimmige Beschlüsse vom Landesparteivorstand und wir werden das bei den Landtagswahlen schon so umsetzen. Wir wollen viele einladen – wie seinerzeit Bruno Kreisky – ein Stück des Weges mit der steirischen Sozialdemokratie zu gehen.Sie waren einer der Ersten, der die Reichensteuer gefordert hat. Glauben Sie, werden Sie mit der Umsetzung der Reichensteuer schon in den Wahlkampf ziehen können?Ich glaube, dass die Regierung schon bis zum Sommer Klarheit geschaffen hat, wie sie die Gegenfinanzierung von fünf bis sechs Milliarden für die Lohnsteuersenkung aufstellen will. Ich habe Steuerrecht studiert und war 13 Jahre Finanzvorstand in einem Unternehmen. Ich kenne die sieben Einkunftsarten sehr gut und weiß, wie z. B. Konzerne steuerschonend agieren können. Man soll mir einmal erklären, warum die CDU/CSU in Deutschland die Erbschaftssteuer wieder eingeführt hat – und bei uns ist die ÖVP dagegen. Was hat Erben mit der Leistung jener zu tun, die erben? Was sind das für Signale? Ich habe nie von Reichensteuer gesprochen, sondern ich meinte immer vermögensbezogene Steuern. Ich brauche nicht den Rückenwind einer Reichensteuer, sondern den Rückenwind einer starken Regierung.Wie werden Sie die Kasernenschließungen im Wahlkampf verkaufen?Die Schließung der beiden steirischen Kasernen war schon seit 2005 beschlossen. Daher ist es für uns keine große Überraschung. Aber es geht um einen ganz anderen Punkt: Welchen Beitrag ist Österreich überhaupt noch imstande zu leisten, wenn es eine europäische Aktion im Sinne von Landesverteidigung geben müsste. Von sehr hohen Offizieren weiß ich, dass wir nicht einmal in der Lage sind, eine Brigade über alle Waffengattungen zur Verfügung zu stellen. Dann soll sich die Bundesregierung schon gut überlegen, welche Wertschätzung das in der Staatengemeinschaft auf Zeit bedeutet.Wie hält man sich als 61-Jähriger fit für einen Wahlkampf? Sie haben deutlich abgenommen ...Die Diät habe ich mir zum 60. Geburtstag geschenkt. Mit der Dukan-Diät (Anmerk. d. Red.: Diät mit 4 Phasen und Eiweiß-Schwerpunkt) habe ich 15 Kilo abgenommen. Meine Frau hat extra für mich nach diesem Prinzip gekocht. Das war auch notwendig, weil ich aus meiner Zeit als Eishockey-Spieler mit den Bandscheiben Probleme habe. Mittlerweile praktiziere ich dieses Ernährungsprinzip schon automatisch und denke gar nicht mehr daran. Erst ab diesem Zeitpunkt hat man die Ernährungsumstellung geschafft. Aber nicht nur deswegen fühle ich mich fit für den Wahlkampf 2015.2014-10-11  |
Kaum sagt ein Schwarzer was G'scheites - is a Roter gleich dagegen! |
Wären seine Argumente wenigstes so eingängig, wie die seiner "politischen Gegner", könnte man darüber diskutieren.
Tatsächlich aber ist es nur "Gesudere" (© Gusenbauer):
"Das sei aus regional wirtschaftlicher Sicht mehr als fragwürdig
- und schaukle nur die Bevü ölkerung auf.
Lieber Josef,
beruhigen Sie sich, noch sind keine Bürgerrevolten der Tunnel wegen in Sicht.
Benden Sie Ihren "regional wirtschaftlichen Tunnelblick" und realisieren Sie bitte,
dass es hier um bundespolitische Fragen geht.
Denn nur wenn's dem Land Österreich gut geht,
kann der Finanzausgleich auch Ihre Region mit Geld beglücken.
Und nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihren Landeshauptleuten, die MITEINADER reden, einander zuhören und sogar Ideen des "politischen Gegners" aufgreifen und zum Wohl Ihres Bundeslandes umsetzen!
Setzen Sie sich bitte mit dem Kulturschock des "MITEIANDER statt gegeneinander" auseinander!
2014-10-11  |
'raus aus den Tunneln! |
"13,000,000.000 € sinnvoll aufbringen!
 Kaum jemand hält sie für sinnvoll,
Kaum jemand hält sie für sinnvoll, kaum jemand glaubt an ihre Wirtschaftlichkeit
- also lasst sie bleiben!
Die 13Mrd. € könnt ihr dann anders besser investieren
- ein Jahr lang 2,600.000 Kindergartenplätze finanzieren oder
- ein Jahr lang 288.888 Lehrer bezahlen oder
- die Uni's bei Einsatz der Drittmittel unterstützen
- oder, oder, oder ....
Heute melden sich der Nationalbankpräsident Claus Raidl und der ehemalige ÖVP-Mandatar Ferry Maier mit der Idee, Mittel zur Konjunturbelebung durch den Aufschub der milliardenschweren Tunnelprojekte - Semmering-Tunnel und Brennerbasis-Tunnel - um 5 Jahre, frei zu machen (Die Arbeiten am Koralm-Tunnel sind schon zu weit fortgeschritten).
"Die freiwerdenden Mittel sollten besser für sozialen Wohnbau, Kindergärten, Schulen und thermische Sanierung verwendet werden. Auch sollte es eine auf zwei Jahre befristete Prämie von zehn bis 15 Prozent für Investitionen in maschinelle Ausrüstung geben."
26,7 Milliarden davon für Bahninfrastruktur (hauptsächlich Tunnelbauten),
6,2 Milliarden für Zuschüsse zu den ÖBB. Insgesamt sollen sich die Belastungen bis 2065 auf 68 Milliarden belaufen.
Maier hatte im Parlament gegen dieses Vorhaben gestimmt.
No, jetzt sind auch ein paar honorige Herren auf die gute Idee gekommen, ein paar - so
ca. 20 Milliarden Euro - in Maßnahmen mit deutlich besserem Beschäftigungseffekt als die "Prestige"-Investitionen in Bahnprojekte zu stecken.
Bures hat damals nicht hören wollen, vielleicht hören jetzt Mittelehner und Schelling zu!?
P.S.: Wenn wir jetzt noch die HYPO endlich in Konkurs schickten, wär' sogar noch eine Steuerentlastung - ohne neue Steuern - in Sicht!!
2014-10-11  |
Ist der schwindligste Bachelor-Abschluss mehr wert als ein Meister seines Handwerkes? |
Wieder einmal schreibt Martina Salomon im KURIER unter dem Titel
Elitenförderung heißt auch das Handwerk zu fördern
einen lesenswerten Artikel. (Wenn nicht mehr online: Archiv)
Wichtigste Zitate:
Statt sinnlos Berufe zu akademisieren, sollte lieber die in Westösterreich funktionierende Fachkräfteausbildung gestärkt werden.
Weltweit ist Österreich Vorbild für die Berufsausbildung, obwohl sie im eigenen Land immer weniger gilt.
OECD-Experten (??)reden uns nämlich seit Jahr und Tag ein, die Zahl der Akademiker dringend zu erhöhen.
Wozu? Vielleicht um noch mehr arbeitslose (Pseudo-)Akademiker zu erzeugen?
Seither hat selbst der schwindligste Bachelor-Abschluss ein höheres Ansehen als ein Meister, obwohl dessen Berufsaussichten und Verdienstchancen häufig deutlich besser sind.
In der Ostregion hat die Überforderung der Pflichtschulen mit Integrationsaufgaben zuerst das Image der Hauptschule und dann jenes der handwerklichen Berufe beschädigt.
Das ganze Land braucht Fachkräfte – je gebildeter, desto besser.
Daher ist es absurd, dass man zwar von der Schule fordert, Stärken zu stärken – in der Bildungspolitik aber darauf vergisst.
Der Wettbewerbsvorteil der dualen Ausbildung ließe sich ausbauen.
Statt Geld für Gesamtschulmodelle in Regionen zu stecken, wo es gar kein Gymnasium gibt (Zillertal, Bregenzerwald: dort sind die Hauptschulen ohnehin quasi Gesamtschulen), könnte man eine Modellregion "Lehre mit Matura" schaffen.
"Elite ist das Einzige, was zählt", meinte Genetiker Markus Hengstschläger Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Wien.
Warum lesen unsere Politiker, i.B. Frau Heinisch-Hosek, derartige "salomonische" Artikel nicht?
Warum hören sie Wissenschaftern nicht zu?
Vielleicht, weil sie für derartig pragmatische Ansätze zu arrogant, ignorant oder schlicht zu doof sind?
2014-10-03  |
Leistung und Elite sind gewerkschaftlich verbotene Schimpfwörter |
Einmal mehr ein Artikel, den man nur voll unterschreiben kann!
Das türkische Bildungsystem liest sich wie das
Fremdwörterbuch von Heinisch-Hosek:
- klare Leistungs- und Bildungsorientierung
- Selektion fast in US-Manier
- ein differenziertes Schulsystem wie in Österreich - wir wollen's abschaffen.
- Tests, bei weniger als ein Drittel bestehen - bei uns war Ressourcenknappheit, die zu Aufnahmetests führte
- die Unis verlangen Gebühren
- Die Jungakademiker sprechen exzellentes Englisch - unsere nicht einmal korrektes Deutsch
All das scheint für unsere "Bildungspolitiker" aus dem Gebetbuch des Teufels zu sein!
Leistung und Elite sind in Österreich gewerkschaftlich verbotene Schimpfwörter!
Die Türkei ist - interessanterweise - ein modernes Beispiel!
2014-09-30  |
Die Versammlungsfreiheit "sticht" Bewegungsfreiheit! - (VfGH im April 2014) |
Das Recht auf Demo im Bademantel
|
Elias Natmessnig - Kurier 2014-09-30 |
Lt. Versammlungsgesetz sind Versammlungen nur dann zu untersagen,
wenn die Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährden.
- „Die Versammlungsfreiheit sticht in diesem Fall die Bewegungsfreiheit.“ - zeigt. Die Demonstrationsfreiheit ist zweifelsfrei eine der größten Errungenschaften der Demokratie.
Allerdings wird dieses Recht immer öfter lächerlicher gemacht, es scheint oft nur darum zu gehen, andere zu ärgern. Entscheiden Sie selbst, wie ernsthaft oder wichtig die Anliegen der Demo-Vernstalter waren!
Die - unvollständige - Auflistung der Ringstrassen-Demos bis heute:
Am 11.1. fand eine Demo gegen den "Massenmord an Streunern in Rumänien" statt. Auch am 1.3. und am 17.5 wurde für die Hunde protestiert. Die Demonstration gegen den Akademikerball der FPÖ fand am Freitag, 24. 1. statt. Für die Unterstützung der Proteste in der Ukraine wurde am 26.1. protestiert. Am 28.1. fand ein Autokorso zum Thema statt. Eine Folge des Akademikerballs: Am 7.2. marschieren Demonstranten für einen "Rücktritt des Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl". Am 1.3. wurde gegen die Erhöhung der motorbezogenen Versicherungssteuer NoVA demonstriert. 7.3.: Für "Demokratie und gegen den Militärputsch in Ägypten". Ebenfalls im März: „Für den kürzlich in der Türkei verstorbenen Berkin Elvan.“ Die "Hypo-Alpe-Adria-Bank" war am 10. und am 28.4. Thema einer Demo. Weiters wurde wieder gegen den Militärputsch in Ägypten (20.4) und für den Frieden (26.4.) demonstriert. Am 30.4 folgte auf die Demo „Für die Freigabe von natürlichem Cannabis in der Medizin sowie als Genussmittel“ ein "Fackelzug der SP-Jugend". Am 10. Mai fand auch die "Peace Parade" statt. Weiters: „Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus“ (8.5.), oder „Nein zum 12-Stunden-Tag“ (12.5). "Freedom not Frontex" hieß es bei einer Demo am 16.5. Auch gegen die "AGRA Gentechnik" (24.5.) und den Krieg in Syrien (30.5.) wurde demonstriert. „Genug gespart! Her mit der Vermögenssteuer!“ hieß es am Freitag, dem 13. 6. An diesem Tag fand auch die Demo: „F13 – Die Stadt gehört uns und die 18 Milliarden eigentlich auch“ statt. Der Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 19. Juni in Wien rief auch seine Gegner auf den Plan. Der Besuch von Wladimir Putin am 24. 6. war gleich von zwei Demos begleitet. Eine davon "To Russia With Love Austria -Regenbogenmarsch" (Bild) richtete sich gegen Homophobie. Am 6. Juli wurde gegen die "Aufstellung einer chinesischen Bohrplattform in vietnamesischen Gewässern“ protestiert. Gegen „Menschenrechtsverletzungen gegenüber Falun Gong-Übenden in China“ richtete sich eine Demo am 19. 7. Am 20.7 hieß es "Mehr Rechte für Biker" Bei "Rasen am Ring" am 22.9 war der Ring zwischen 10 und 22 Uhr autofrei. Der Marsch der Wutbürger: Für das Kulturerbe in Wien setzten sich Demonstranten am 25. 9. ein. „Freiheit für mehr Musik von Udo Jürgens“ am 30.09 war der "krönende" Abschluss der - tw. skurrilen - Demonstrationsorgie. Hier zur Kurier-Fotostrecke: Wien: Der Ring als politischer Tummelplatz2014-09-24  |
Ring fei! für alle Müßiggänger, Werbemärsche, Grüne und anderes Seltsames |
Zumindest empfanden sie es so: Tatsächlich wird ein Stau aber natürlich davon erzeugt, dass zu viele Pkw in Wien unterwegs sind, dass in so einem Pkw häufig nur eine einzige Person sitzt und dass die Hälfte dieser Pkw eine Fahrt unter fünf Kilometer zurück legt. Den Stau erzeugen, seien wir uns ehrlich, die schlecht genutzten Autos – nicht die Leute, die sich auf Rädern oder zu Fuß auf dem für ein paar Stunden gesperrten Ring tummeln.
Ja wat denn nu?
War's der 12 Sruden lang gesperrte Ring (der von 50(!!), später am Abend bis zu tollen 400 "Freizeitgeniessern" besucht wurde) oder waren es die zahllosen, arbeiteten Idioten, in ihren "zu vielen, schlecht genutzten Autos" auf den Ausweichrouten zusätzliche Abgase, Feinstaub und Stress erzeugten?
Nur ein intelligenzferner Mensch - also ein Idiot, fährt heutzutage freiwillig durch Wien und da auch noch durch die Innenstadt - Sightseeing-Busse natürlich ausgenommen ;-)
Ungehindert bedeutet: ohne, dass man als Fußgängerin permanent warten muss, dass einem Fußgeher-Ampeln erlauben, die Straße zu überqueren. -
Ja, naaaatürlich, man muss FUSSGÄNGERSTAU's vermeiden!
... sinnvollere innerstädtische Fortbewegungstechniken. Die gehören unterstützt, beworben, gefördert, in jeder Hinsicht: das Gehen zum Beispiel. Gehen ist super. Kost nix¹), schadet der Umwelt nix, nützt aber viel, denn es hat einen großen gesundheitlichen Nutzen ...
Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou plant Fussgängerleitsysteme er- und 6 eigene "Highways"/"Flanierrouten" durch die Stadt einzurichten.
¹) und sie kosten 8.300 Euro pro Stück !!!!
2014-09-24  |
Ist Doris Knecht von Vassilakou? |
Zumindest empfanden sie es so: Tatsächlich wird ein Stau aber natürlich davon erzeugt, dass zu viele Pkw in Wien unterwegs sind, dass in so einem Pkw häufig nur eine einzige Person sitzt und dass die Hälfte dieser Pkw eine Fahrt unter fünf Kilometer zurück legt. Den Stau erzeugen, seien wir uns ehrlich, die schlecht genutzten Autos – nicht die Leute, die sich auf Rädern oder zu Fuß auf dem für ein paar Stunden gesperrten Ring tummeln.
Ja wat denn nu?
War's der 12 Sruden lang gesperrte Ring (der von 50(!!), später am Abend bis zu tollen 400 "Freizeitgeniessern" besucht wurde) oder waren es die zahllosen, arbeiteten Idioten, in ihren "zu vielen, schlecht genutzten Autos" auf den Ausweichrouten zusätzliche Abgase, Feinstaub und Stress erzeugten?
Nur ein intelligenzferner Mensch - also ein Idiot, fährt heutzutage freiwillig durch Wien und da auch noch durch die Innenstadt - Sightseeing-Busse natürlich ausgenommen ;-)
Ungehindert bedeutet: ohne, dass man als Fußgängerin permanent warten muss, dass einem Fußgeher-Ampeln erlauben, die Straße zu überqueren. -
Ja, naaaatürlich, man muss FUSSGÄNGERSTAU's vermeiden!
... sinnvollere innerstädtische Fortbewegungstechniken. Die gehören unterstützt, beworben, gefördert, in jeder Hinsicht: das Gehen zum Beispiel. Gehen ist super. Kost nix¹), schadet der Umwelt nix, nützt aber viel, denn es hat einen großen gesundheitlichen Nutzen ...
Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou plant Fussgängerleitsysteme er- und 6 eigene "Highways"/"Flanierrouten" durch die Stadt einzurichten.
¹) und sie kosten 8.300 Euro pro Stück !!!!
2014-09-25  |
Wien ist Mekka! nicht für Muslime, sondern für Demonstranten! |
Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht
- wieviel Dreck durch die im Stau stehenden Autos in die Luft geblasen werden?
- wieviel zusätzlichen Stress Ihr bei anderen Menschen auslöst?
- was Ihr - möglicherweise nicht - bewirkt?
2014-09-20 "Marsch für Jesus" 4 Stunden Ring-Sperre
2014-09-22 "Rasen am Ring" (50 Teilnehmer, am Abend 400) 12 Stunden Ring-Sperre
2014-09-25 Marsch der Wiener Wutbürger
2014-09-30 Bademantelparade Werbeveranstaltung Madame Tusseaud
7 Stunden temporäre Sperren in der Innenstadt
2014-09-30 Vienna Night Run Werbeveranstaltung erste bank vienna
3 Stunden Sperre am Ring und Kai
Nur weil Wien das Dorado der "Aktionisten" ist,
muss doch nicht jede Gelegenheit zur "Stau-Provokation" genutzt werden!
| Stadt | Einwohner | "Aktionen" 2013 | "Aktionen" pro 1.000 EW |
bis heute / p.a. |
| Hamburg | 1.746.342 | 1.782 | 1,02 | 1.407 / 1.960 |
| Berlin | 3.419.623 | 4.487 | 1,31 | 3.246 / 4.328 |
| Wien | 1.781.105 | 10.573 | 5,54 | 7.374 / 9.832 |
Ja, ja in Wien da ist was los!
Fast 5x so viel wie in Hamburg oder Berlin!
Liebe Junge Grüne:
Ihr braucht sie nicht extra einladen - die germanischen Profidemonstranten -
die haben schon längst geschnallt, wo 5mal soviel los ist, wie in der Heimat!
Der ARBÖ kritisiert in einer Aussendung die Häufung an Demonstrationen auf der Ringstraße und appelliert an die Behörden, Maßnahmen zu treffen, damit die Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werde, ohne das Grundrecht auf Demonstrationen zu unterlaufen.
Die Staus „verärgern im Prinzip alle Mobilitätsgruppen, kosten Zeit und unnötig viel Geld“, so Kurt Sabatnig vom ARBÖ.
In der „Kronen Zeitung“ spricht Bürgermeister Häupl von einem „Missbrauch des Demonstrationsrechts“ und regt an, das Gesetz zu adaptieren. Doch der Polizei sind die Hände gebunden. Eine ordentlich angemeldete Demonstration kann weder örtlich noch zeitlich eingeschränkt werden, wird Polizeijurist Manfred Reinthaler zitiert.
„Jux-Demos auf Kosten der Allgemeinheit seien indiskutabel“, sagte der Wiener ÖVP-Chef Manfred Juraczka in einer Aussendung. Er begrüßt den Vorstoß von Häupl und schlägt vor, dass sich Parteien, Sozialpartner und Mobilitätsclubs an einen Tisch setzen und über einen Gesetzesänderungsentwurf beraten.
Dann ändert doch endlich das Gesetz und
schickt die Aktionisten auf die Hauptallee und oder die Donauinsel!
2014-09-21  |
Politische Kastenangehörige sind schwer vermittelbar! |
Die politische Kaste hat mit Ausnahme ihrer politischen Karriere keine befriedigende Alternative.
Dieser Zustand setzt schon sehr früh ein, spätestens um die 40.
So wird die Wiederwahl zum einzigen und vordringlichen Ziel.
In der Folge geht es nicht mehr darum, gute Politik zu machen,
sondern nur darum, wiedergewählt zu werden.
Das ist die Schwäche des Systems. Hans Peter Haselsteiner, Kurier vom 21.09.2014
Wenn nun - Gott soll abhüten - auch noch der Bundesrat aufgelöst wird und die Sanktionen dazu führen, dass russische Oligarchen keine abgehalfterten Politiker als "Berater" brauchen - was soll dann aus unserem Politikemeriten werden?
Für produktive Arbeit sind sie ja eher schwer vermittelbar ;-)
2014-09-22  |
Tempo 30 und "Rasen am Ring" |
ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer: "Je mehr eine 30er-Zone von Verkehrsteilnehmern als nicht notwendig empfunden wird, desto häufiger wird die Bestimmung auch übertreten." Nachsatz: "In der Folge ist zu befürchten, dass gerade an solchen Stellen vermehrt gemessen und natürlich abkassiert wird."
uch bei den Wiener Linien gibt es Probleme mit Tempo 30. Denn bei langsamerer Fahrt müssen – um Intervalle einzuhalten – mehr Busse eingesetzt werden. Sprecher Answer Lang: "Dadurch entstehen höhere Kosten. Unser Anliegen aber ist es, Fahrgäste möglichst rasch und günstig von A nach B zu bringen."
Die politische Kaste hat mit Ausnahme ihrer politischen Karriere keine befriedigende Alternative.
Das Sicherheitsargument ist plausibel. Aber 30 km/h sind kein Allheilmittel gegen Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Die meisten Autos sind nicht für diese Geschwindigkeit als Regelbetrieb ausgelegt. Um unter Tempo 30 zu bleiben, muss man dauern schalten, bremsen und wieder anfahren." Auch das Lärmargument gilt für Schneider nicht: "Unter 50 km/h gibt es bei der Lautstärke kaum Unterschiede."
So wird die Wiederwahl zum einzigen und vordringlichen Ziel.
In der Folge geht es nicht mehr darum, gute Politik zu machen,
sondern nur darum, wiedergewählt zu werden.
Das ist die Schwäche des Systems. Hans Peter Haselsteiner, Kurier vom 21.09.2014
Wenn nun - Gott soll abhüten - auch noch der Bundesrat aufgelöst wird und die Sanktionen dazu führen, dass russische Oligarchen keine abgehalfterten Politiker als "Berater" brauchen - was soll dann aus unserem Politikemeriten werden?
Für produktive Arbeit sind sie ja eher schwer vermittelbar ;-)
2014-08-29  |
Der Obmann, die Warlords, deren Hintersassen und die Bünde |
Zugegeben, die Aussage "zum jetzigen Zeitpunkt" hört sich eher "situationselastisch" an,
ist damit der ZeitPUNKT des Interviews gemeint,
oder kann man auf eine längere gerade Strecke hoffen?
Eine gerade und harte Linie wäre dem neuen Obmann zu empfehlen, auch sollte er dringend auf den Ex-ÖVP-EU-Kommissar Franz Fischler: "Eine Grundsatzdebatte und eine komplette Neuaufstellung sind nötig – strukturell und inhaltlich. " hören und gemeinsam mit ihm den Warlords klarmachen: "Wenn man die Fundamente nicht ändert,
wird man in zehn Jahren diskutieren, wie man auf zehn Prozent kommen kann."
Eine strukturelle Neuaufstellung" ist besonders im Bereich der 6 Pfündnerbünde zu empfehlen, damit Frau Mikl-Leitner und ihr (ÖAAB)-Flügerl sich nicht mehr übervorteilt(!!) fühlen müssen, weil nach dem Abgang von Spindelegger und Danninger (beide ÖAAB) der Wirtschaftsbund "deutliches Übergewicht im ÖVP- Regierungsteam bekommt" - gehören die nicht alle zur selben Partei?.
Auch Onkel Erwin schmollt: "Wenn Parteichef Mitterlehner ihn (Schelling) für richtig hält, wird er wissen, was er tut.",
Eine wirklich motivierende und unterstützende Aussage aus St. Pölten - kein Wunder, wenn NÖ-Hockaräter Pernkopf (mangels fachlichem Wissen) und Haber (mangels politischer Erfahrung) durch den Rost gefallen sind.
Äätsch, er wird schon wissen, was er tut!
Die Formulierungen des ehemaligen steirische Wirtschaftslandesrat Herbert Paierl:
"Leadership nach innen und außen ist das Entscheidende. Daran wird der Obmann gemessen." und auf die Landeshauptmänner gemünzt:
"Der Schwanz darf nicht mit dem Hund wedeln."
seien dem neuen Obmann ins Stammbuch geschrieben, täglich sollte er sie lesen und danach handeln!
Die Ernennung von Schelling mag als erster Schritt in eine neue Richtung gewertet werden. Der als ehrgeizig und humorvoll beschriebene Macher-Typ meint, dass die Regierung harte Schritte bei Verwlatungsreformen, bei Pensionen und der Bildung setzen muss und sagte bereits im April: „Die Angst vor Unbeliebtheit muss die Regierung eh nicht mehr haben.“
Die meisten Kommentatoren schreiben, dass "Herkulesaufgaben" auf den Obmann und sein Team warten -
wieso fallen einem da spontan die Ställe des Augias und die Hydra ein?
P.S.: Vielleicht sollte Mitterlehner auch die Pressestimmen zum Spindelegger-Rücktritt sorgfältig lesen und daraus Handlungsnotwendigkeiten ableiten. ... wenn nicht mehr online: Archiv
2014-08-26  |
Weg frei für eine "entfesselte" ÖVP! - weg mit den Bünden! |
"Zu eng, zu starr" ... wenn nicht mehr online: Archiv
In der ÖVP wird der Ruf nach einer Strukturreform laut,
vor allem an den Bünden wird gerüttelt.
Leider nicht stark genug,
leider kaum effektiv!
Warum sollte eine beratungsresistente und realitätsverweigernde Partie (kein Druckfehler!) auf Silberrücken und Jungspunde hören?
Wenn ein - zurückgetreten wordener EX-Obmann - empfiehlt: "Auflösen und neu gründen" dann scheppern die verkalkten Knochen der "aktiven" (?!?) ÖVP-Funktionäre aus Angst ihre Pfründen, Pöstchen und exzessiven Altersversorgungen zu verlieren.
Bündeproporz und Landeshauptleutewünsche statt
sachlicher und sozialer Kompetenz ist die Devise!
Sägen schon die Landeshauptleute an der Einigkeit der Partei (LH Pühringer:"Wir sind keine Untertanen des Bundes.", LH Haslauer: "Wir lassen uns nicht bevormunden") kommen die beleidigten Bünde und fordern proportionale Besetzungen in der Regierung - meist fernab von fachlicher Qualifikation.
SECHS Pfründnervereine - Arbeitnehmer, Wirtschaft, Bauern, Frauen, Junge und Senioren - lähmen die Partei. Dazu meinen Insider:
"Die bündischen Strukturen in den Bezirken und Städten sind nur noch reiner Selbstzweck für die Funktionäre, deshalb sollten sie hier ersatzlos gestrichen werden."
Bünde abschaffen und soziale Milieus als Zielgruppen ansprechen ist eine andere, clevere Idee.
"Das Konzept einer gesellschaftlich breit aufgestellten Integrationspartei ist relevanter denn je, einfach weil die Gesellschaft selbst immer heterogener wird."
"Der Ausgleich innerparteilicher Interessen erfolgt völlig intransparent hinter verschlossenen Türen. Es ist oft sogar schwierig, nur den Ort einer sachpolitischen Entscheidung herauszufinden"
Die Kritik an der Schwäche der Bundes-ÖVP - und damit verbunden auch des Parteiobmanns - haben Landeshauptleute und Bünde selbst verursacht.
Um wahlpolitisches Kleingeld zu machen, nutzen sie jede Gelegenheit den "Bund" für angeblich Schlechtes zu tadeln und sich selbst als Opfer der Bundespolitik darzustellen.
Der von Strolz vorgeschlagene "Super-Wahlsonntag" (Zusammenlegung möglichst aller Regional- und Kammerwahlen) wäre - nicht nur aus Kostengründen - ein zielführender Vorschlag.
Die beim "Obmann-bashing" so beliebte Steuerdebatte könnte man einfach lösen:
Beendet den Finanzausgleich und gebt den Ländern die Steuerhoheit - dann könnten sie nicht mehr blöken, sondern müssten tun!
Mal sehen welche Maulaffen sie dann feilhalten! Und wie sie dann IHREN Wählern erklären warum was nicht geht.
Die Schweizer können das und fahren offenbar gut damit.
Deutschland's CDU zeigt, dass eine bürgerliche Integrationspartei mit den richtigen Personen, Themen und Zugängen mehrheitsfähig sein kann.
Die weniger als 700.000 ÖVP-Mitglieder sollten sich darüber Gedanken machen, ob ihre Partei mit den jetzigen Strukturen überlebensfähig ist, oder ob endlich eine "Evolution Volkspartei" stattfinden soll.
Wacht auf! Es ist bereits 5 NACH zwölf!
2014-08-27  |
Landeshauptleute und Bünde - die Totengräber der ÖVP |
Läutet er damit eien neue Runde zum Obmannschlachten ein
- noch bevor dieser gewählt/bestätigt ist?
Oder macht er sich als niedlicher Egomane wichtig?
Oder singt er das Lied seiner ÖVP-Kollegen - die der Bundespartei "loyal" zur Seite stehen - und anderer Zurufer weiter, das in der Vergangenheit so klang:
LH Pühringer, entgegen der (Bundes-)Parteilinie konnte sich "eine echte Millionärssteuer" vorstellen, aber was er darunter versteht? "Das ist nicht meine Aufgabe."
LH Haslauer hat gegen Vermögenssteuern "grundsätzlich nichts einzuwenden" - allerdings ohne zu wissen oder zu sagen, wie diese - auch seine - Bürger treffen könnten.
LH Platter forderte eine "Kurskorrektur" der ÖVP - ausser den üblichen "volksnahen" Plattitüden war aber nichts wirklich Entscheidendes zu hören.
Erheben sich die Fragen:
- wann der Wirtschaftskammer-Präsident Leitl seinem Obmann via Medien ausrichten wird, das selbiger als Wirtschaftsminister und Parteiobmann überfordert sei und
- wann der Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl Mitterlehner zum Rücktritt auffordern, weil selbiger - vernünftigerweise - auch gegen Vermögenssteuern auftritt
- wann Noch-Landeshaupmann Wallner seine kryptische Aussage:
- wann LH Pühringer wieder einmal feststellt "Wir sind keine Untertanen des Bundes."
- wann LH Haslauer dem Obmann ausrichten wird: "Wir lassen uns nicht bevormunden"
So leistet sich eine ehemals "staatstragende" Partei eine kläffende Opposition aus den eigenen Reihen, die mit ihrer "Loyalität" emsig am Grab der ÖVP schaufelt.
Wahrlich, wahrlich: In der untergehende Sonne werfen selbst Zwerge noch große Schatten!
P.S.: Laokoon sagt in der Aeneis (Buch II, Vers 48-49):
Equo ne credite, Teucri! Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
(„Traut nicht dem Pferde, Trojaner! Was immer es ist, ich fürcht' die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen.“
Ob die angebotene Gabe aus St. Pölten
- der Jurist und Agrarlandesrat Stephan Pernkopf als Finanzminister -
als ein derartges Geschenk zu sehen ist, könnte man anhand der bisherigen Gaben
- Strasser, Mikl-Leitner, Spindelegger, Gabmann, Prokop, Josef Pröll -
relativ leicht überprüfen ;-))
2014-08-24  |
"gemäßigter" Islam - eine Fiktion! |
und wo sind nun die grünen nazijägerinnen wie glawischnik, und lunatscheck, die jungen grüninnen, der schwarze block, der bock , die kerzen marschierer und donnerstagsdemonstrantinnen, de akkademikerbal demonstrierer, der kurz, ...schauen alle zu wie der heutige genozid stattfindet.
aber nacher schreinen sie wieder wehret den anfängen und nie wieder ....
die sind um nix besser als die damaligen mitläufer.
bemerkenswert ist auch dass die moslems sich nicht lautstark von dem genozid ihrer glaubensbrüder distanzieren, was ich als stillscheigende zustmmung werte.
2014-08-08  |
Was wir von Islamic Banking lernen müssen! |
Die Auslöser der letzten Wirtschaftskrisen in der westlichen Welt waren
Geld wurde verliehen um mit noch mehr Geld in Finanztransaktionen zu investieren.
Den Geschäften lagen keine realen Vorgänge zu Grunde
Die wilden Spekulationen von Goldman Sachs (u. A. gegen die eigenen Kunden),
Lehmann Brothers und diversen anderen - meist BANKEN - haben die Krisen ausgelöst.
Betrachtet man - ohne die reflexartigen Reaktionen, dass alles was islamisch ist, schlecht sein muss - dann sollten einige der Grundlagen dieses Banksystems in die Bankgesetze der westlichen Welt integriert werden.
Die Eckpfeiler des Islamic Banking
Grundpfeiler ist das Verbot von Zinsen.
Wer sein Geld daher nach islamischen Regeln ("Halal") anlegt, wird am künftigen Gewinn - oder Verlust - der Bankgeschäfte beteiligt. Garantie für eine bestimmte Verzinsung gibt es nicht.
Zweiter Grundsatz ist, dass jeder Transaktion ein reales Geschäft zugrundeliegen muss. Geld darf nicht Geld verdienen, sondern muss dazu verwendet werden, reale Geschäfte zu finanzieren. Spekulation ist ebenso verboten. Dennoch können islamische Banken die meisten bekannten Bankprodukte anbieten, von Kreditkarten - ohne verzinsten Überziehungsrahmen - bis zu Leasing.
Islamisches Banking untersagt Investitionen in Geschäfte, wo Alkohol oder Schweinefleisch im Spiel ist - also auch in Restaurants, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Verboten ist es auch, Geld in Glücksspiel, konventionelle Banken oder Versicherungen, die Rüstungsindustrie, die Unterhaltungsindustrie, die Klon- und Stammzellenforschung oder allgemein umwelt- und gesundheitsschädigende beziehungsweise arbeitnehmerdiskriminierende Unternehmen zu investieren.
Besonders wichtig wäre:
Geld darf nur reale Geschäfte finanzieren und das Verbot von Spekulation.
Das Verbot der Finanzierung von Rüstungsindustrie, arbeitnehmerdiskriminierende bzw. umwelt- oder gesundheitsgefährdende Betrieben, könnte darüberhinaus unsere Bankwelt in eine bessere und gesündere wandeln.
Mit der Implentation dieser Gesetzeserweiterungen hätten Gutmenschen, Grüne und unser mäßig begabtes Spitzenduo ein Betätigunsfeld, das nicht nur moralisch, sondern auch wirtschaftlich höchst wünschenswerte Egebnisse bringen kann!
2014-08-05  |
"Täterschutz - die erste Pflicht im österr. Rechtssystem
CONSTRUCTION ZONE!
-->
2011-05-10 Standard Neues Gutachten zu haftunfähigem Wr. Neustädter Missbrauchstäter
Elsner: Gericht beschließt Haftunfähigkeit 28.02.2013 Presse
2014-08-05  |
" Barbara Prammer - requiescat in pace |
Nachhilfe für Genderismus-Fans |
Jetzt die Feminismuskritik.
Die Genderfrauen sagen, dass es "Männer" und "Frauen" in Wirklichkeit gar nicht gebe, dies seien nur gesellschaftliche Konstrukte. Tatsächlich sind die Grenzen zwischen den Geschlechtern fließend, es gibt organisch, sozial und psychisch die verschiedensten Zwischenformen.
Das ist bei Cola und Limo genauso.
Du kannst Cola und Limo in jedem gewünschten Verhältnis zu Spezi mischen.
Wenn nun einer käme und behauptete, aus der Existenz von Spezi gehe hervor, dass Cola und Limo ein gesellschaftliches Konstrukt seien und gar nicht existierten, dann würde jeder sofort merken, dass diese Person ein Rad abhat.
Noch irrer wäre die Behauptung:
"Wer darauf beharrt, dass es Cola gibt, der diskriminiert Spezi." Quelle: Zeitmagazin
2014-08-02  |
"Heisse Kartofflen" (Mietrecht) für Vassilakou! |
Das Mietrecht ist Bundesangelegenheit, was kann hier die Stadt ausrichten?
Wir brauchen einen Mietrechtsgipfel. Das ist meine Forderung an die Bundesregierung. Denn sie haben vor zwei Jahren, als das Thema hochkochte, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um es darin zu versenken. Damit muss jetzt Schluss sein.
Das ist aber alles ferne Zukunftsmusik.
Wir könn(t)en schon jetzt einiges gegen Spekulation unternehmen. Wir müssen unsere Möglichkeiten nur rigoros einsetzen. Die Stadt kann sehr wohl, selbst bei Gericht, Anträge einbringen, um Spekulanten zur Sanierung zu zwingen. Das wurde bis jetzt noch nicht gemacht, hätte aber abschreckende Wirkung. Der Besitz von Wohnungen ist nicht nur da, um Profit zu machen, sondern bedeutet auch Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft.Das Mietrechtsgesetz sieht im §6 vor, dass eine Immobilie vorübergehend in die Zwangsverwaltung der Stadt übergehen kann, wenn sich der Eigentümer weigert, Sanierungen durchzuführen.
Warum haben Sie diese Möglichkeit "bis jetzt nicht rigoros" eingesetzt??????
Warum schieben Sie die Verantwortung der Bundesregierung zu, wenn Sie JETZT bereits Handlungsmöglichkeiten hätten?
Wahrscheinlich ist Ihnen und Ihrem Bürgermeisterlein die Kartoffel zu heiss,
aber grün und sozial wäre es allemal, wenn Sie zupackten, anstatt die Dinge - wieder einmal - auf die lange Bank zu schieben!
P.S.: Bei der ach so wichtigen MAHÜ waren Sie schneller und konsequenter,
haben Sie da Ihre ganze Kraft verbraucht?
Oder ist Ihnen Mieter schützen zu wenig publikumswirksam?
2014-08-02  |
Früher waren Kommunisten rot jetzt sind sie grün! |
Gut, dass sich die Grünpolitiker einmal mehr ideologisch deklarieren - als Neu-Kommunisten.
Die Abschaffung von befristeten Verträgen stellt die de facto Enteignung der Haus- und Wohnungseigentumern dar.
Ein unbefristete Mietvertrag ist nahezu unkündbar, einen säumigen Zahler hinauszubekommen ist schwierig, kostenintensiv und nahezu unmöglich. Deshalb wird derzeit meist nur befristet vermietet.
Die von Vassilakou geforderten Mietzinsobergrenzen und die steigenden Erhaltungspflichten des Vermieters führen zu Verlustgeschäften für jeden Vermieter. Dann lieber leer stehen lassen. Da gibt es wenigstens keinen Ärger mit Mietern und Finanz.
Auch der Vorschlag vom grünen Planungssprecher Christoph Chorherr, trägt intensiv kommunistische Züge. Er will Grundeigner, die Gründe horten, notfalls zum Verkauf zwingen!
Die Dolmetscherin Vassilakou, deren politische Initiation bekanntlich in Österreichs bekanntester Institution für demokratische Bildung, der ÖH, begonnen hat, schöpft aus Füllhorn ihrer demokratischen Weisheiten, die ja bekanntlich bis ins antike Athen zurückreichen. Ausdieser Zeit (und modernisiert durch die Ansichten eines gewissen Herrn Marx) scheinen auch ihre Rezepte zur Bekämpfung der "Häuserspekulation", des Individualverkehrs und allerlei anderer demokratiewidriger Gewohnheiten von Eigentümern, Autofahrern und anderen Störern der demokratischen Ordnung zu stammen.
ch bin generell der meinung dass die grünen sich in kommunistischen diktaturen wie udssr, ddr, sich mit ihrer umerziehung, tugendterror , gedankenpolizei, meinunggsdikatur sich sehr wohl gefühlt hätten.
"Supervorschlag" unserer Superlinken Frau V. Nach dem Irrsinn Mariahilfertsrasse, der Abzocke der Aurofahrer, der automat. Erhöhung von Gebühren und Abgaben, der Erhöhung der Preise für Tram und Busse - ausser der Jahreskarte - aber da wird wird jetzt nachjustiert. Bei vorzeitiger Kündigung einer Jahreskarte muss Strafe gezahlt werden. Das höchste Defizit in Wien - Trendenz steigend - sollen jetzt den Vermietern die Hände gebunden werden.
Die Neu-Kommunistin fordert die Enteignung der Haus- und Wohnungseigentumer. Nichts anderes wäre die Abschaffung von befristeten Verträgen. Noch schlimmer, dass es auch noch
unbefristete Vermietung einer Enteignung gleichkommt, der unbefristete Mietvertrag nahezu unkündbar ist (versuchen sie mal einen säumigen Zahler hinauszubekommen, schwierig und kostenintensiv) ist unhaltbar, deshalb derzeit nur befristet vermieten.
Die GrünInnen nähern sich immer mehr dem totalen Kommunismus an. Alle Bürger entmündigen, wenn sie sich wehren mit Verhetzungsparagrafen mundtot machen und vor allem alles nach eigenen Vorstellungen regeln und den Rest verbieten. Liebe Frau V-kuh! Wir brauchen keine Mietzinsobergrenzen, wir brauchen Politikerabzockobergrenzen. Oder wer sind die größten Preistreiber beim Wohnen? Richtig: Die Gemeinde Wien mit Ihren ununterbrochenen und überzogenen Abgabenerhöhungen. Hier gehört ein Limit gesetzt!
Ein guter Vorschlag wäre, bei Richtwertmieten die laufenden Zuschläge zu präzisieren und die Anzahl der Zuschläge zu begrenzen. Derzeit können zum Richtwertmietzins beliebig viele Zuschläge erfunden werden.
Sie sollten sich allerdings zuerst mal fragen warum die Betriebskosten in den Gemeindewohnungen um rund 30% höher sind als in Wohnungen die nicht von der Stadt verwaltet werden.
iegt ja wohl auch daran, dass das rote Wien, den Grünen die Möglichkeit gegeben haben, einen Superwohnkomplex zu erschaffen, der ohne Autos sein muß, und dort nur jemand eine Wohnung bekommt, der keine motorisierte Fortbewegung durch Eigenbesitz hat, oder in Zukunft haben wird. Rot und Grün haben keine Berührungsängste, den Leuten Sand in die Augen zu streuen, und zu lügen was das Zeug hält.
Immer feste drauf auf die Kapitalistenschweine
P.S.: Bei der ach so wichtigen MAHÜ waren Sie schneller und konsequenter,
haben Sie da Ihre ganze Kraft verbraucht?
Oder ist Ihnen Mieter schützen zu wenig publikumswirksam?
-
2014-07-31 
ÜMA ein weiteres Nachhilfeinstitut für Heinisch-Hosek? -
ÜBA ist keineswegs ein dialekt-gefärbter Ausdruck für "über", sondern die Abkürzung für die "AMS-geförderte überbetriebliche Ausbildung", die Lehrlingsexperte Egon Blum zu einem Ausbildungs-Kompetenzzentrum erweitern will (offenbar weil das Bundesministerium für Bildung und Frauen keine "Ausbildungskompetenz" aufweist).
Lehrlinge sollen die ersten sechs Monate der Lehrzeit im Ausbildungs-Kompetenzzentrum verbringen, um sich fehlende Qualifikationen (Grundkenntnisse, Sozialkompetenz etc. ) anzueignen.
Die Frage: "Wos ham de eigenlich in da Schui gmocht und glernt?, darf von einem wohlerzogenen Bürger nicht gestellt werden, Frau Heinisch-Hosek hätte sicher ein Taferl parat, mit dem sie diesen zurechttwittern könnte.
Viele Betriebe beklagen bei jugendlichen Bewerbern die schlechten Grundkenntnisse in den wichtigsten Kulturtechniken, gutes Benehmen inklusive. Nun sollen die jungen Leute aufholen, was sie in der Schule nicht gelernt haben!
Somit soll eine weitere staatliche Institution Nachschulung für etwas leisten, was das ursächlich zuständige BMBF offenbar sträflich versäumt hat.
NACHHILFE für Heinisch-Hosek auf österreichisch!
Hat die nicht schon genug Unterstützung durch das inkompetente BIFIE?
-
2014-07-31 
Schützt Wien Immobilienspekulanten? -
Das Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) dokumentiert 16 Zinshäuser im Eigentum der Castella GmbH und ihrer Schwesterfirmen, in denen es zu massiven Problemen durch "spekulationsgetriebene Mieterschikanen" gekommen war.
Allerdings ist nicht bekannt, ob gegen diese "massiven Probleme" in irgendeiner Form gerichtlich vorgegangen worden wäre!
Das Mietrechtsgesetz sieht im §6 vor, dass eine Immobilie vorübergehend in die Zwangsverwaltung der Stadt übergehen kann, wenn sich der Eigentümer weigert, Sanierungen durchzuführen.
In KEINEM der bekannten Fälle hat eine Gericht entschieden, diesen Weg zu wählen!
Im Gegenteil! In den meisten Fällen, in denen Mieter gegen die "Bestandsfreimachung" mit rechtlichen Mitteln vorgangen sind, wurden die Entscheidungen so lange durch die Instanzenzüge geschleppt, bis einige Mieter zermürbt aufgaben.
Wenn aber ein, als Spekulant bekannter, Eigentümer SEIN Recht durchsetzen will, findet sich flugs ein Richter, der Räumngsklage und deren Durchsetzung mit Polizeiunterstützung anordnet!
"Wos hot die Castella wos I ned hob?" mag sich manch einer der Betroffenen fragen - offensichtlich die Unterstüzung des sozial(istisch)en Wien!
-
2014-07-30 
Wann unterschreibt ULHBP ein Gesetz gegen Immobilienspekulanten? -
ULHBP Heinz Fischer hat's getan!
Er hat nach "intensiver Prüfung" das umstrittene Hypo-Sondergesetz unterschrieben, das für einen Schuldenschnitt bei Nachranggläubigern führt. Obwohl es sich "um durchaus ernstzunehmende verfassungsrechtliche Probleme handelt, die aber nicht als 'evidente Verfassungswidrigkeit' qualifiziert werden können".
Im Fall etwaiger Regressansprüche an die Eigentümer Hauses in der Mühlfeldgasse kann er leider kein Gesetz unterschreiben.
Es gibt keine Bestimmung, die Regress ermöglicht. Der Eigentümer haftet nicht dafür, was die Besetzer tun. Der Vermieter hat mit der Einquartierung der Punks nicht rechtswidrig gehandelt – auch wenn die Motive dahinter problematisch sind.
Allerding denkt man im Justizministerium derzeit nicht an eine entsprechende Gesetzesänderung.
Die Poliizei hat angeblich das Justizministerium kontaktiert, das den Fall prüfen werde - im Ministerium weiß man davon noch nichts. Kurioserweise stellt man aber fest, dass für die Prüfung allfälliger Regress-Möglichkeiten die Finanzprokuratur zuständig sei.
Die Verschwendung von Steuergeld zum Schutz von Immobilienspekulanten ist also rechtens?
Ja, weil ein Bezirksrichter die Polizeiunterstüzung angeordnet hat.
Ob der "Assistenzeinsatz" verhältnismässig war, steht auf einem anderen Blatt, dass die Innenministerin noch beschreiben müsste.
ULHBP könnte - statt unterschreiben - seine mahnende Stimme erheben und die zuständigen Politiker auffordern, entsprechende Gesetze zu beschliessen, die Steuerzahler - und auch Mieter - schützen! -
2014-07-29 
"women owned" macht Frauen sichtbar!?! -
Dieses Produkt kommt aus Frauenhand und es ist auch so gekennzeichnet - mit einem Logo women owned !
Die Idee kommt - natürlich - aus Amerika, dem Mutterland der seltsamen Gesellschaftspolitik.
Die US_Supermarktkette Wal-Mart hatte die Idee und druckt das Logo auf ab September auf jene Waren, die entweder aus einem Unternehmen stammen, das von einer Frau geleitet wird oder zumindest zu 51% in weiblicher Hand ist.
"Die Aktion macht erfolgreiche Frauen sichtbar. Diese Initiative wird Aufmerksamkeit schaffen und damit Interesse erzeugen." sagt Marion Maurer von McDonalds.
Bravo Frau Maurer! Ist auch richtig und notwendig, denn
die 2011 von 1,500.000 Frauen gegen Wal-Mart eingebrachte Sammelklage wurde vorerst abgewiesen!
Geklagt wurde wegen extrem schlechter Bezahlung und der Tatsache, bei Beförderungen mehrmals übergangen worden zu sein.
Damit bleiben diese nicht erfolgreichen Frauen weiterhin UNSICHTBAR!
Ob die Heinisch-Hosek bei den Amerikanern Ideen geklaut hat oder umgekehrt, ist nicht erwiesen,
aber zu vermuten.
Wir haben ja auch das Binnen-I und die Töchter in der Bundeshymne und
dafür schlecht bezahlte Frauen an den Supermarktkassen etc.
Auch hier ein wahrer Sieg der selbsternannten Frauenvertreter,
die von keiner Frau gewählt wurden!
P.S.: Wal-Mart verweigert seinen Angestellten weiterhin Arbeits- und Gewerkschaftsrechte!
Dafür ist er aber lobenswerterweise auf dem "feministischen Trip" !
P.P.S.: Mir ist es völlig egal, ob shareholder, Besitzer oder Mitarbeiter eines Betriebes weiblich oder
männlich sind, für mich entscheidend sind Produktqualität und Preiswürdigkeit -
auch wenn mich Feministinnen dafür verdammen könnten! -
2014-07-28 
Die Zauberlehrlinge im 2ten kosten uns wahrscheinlich über 600.000 €! -
Mit einem neuen Hauseigentümer fing die Geschichte in der Mühlfeldgasse 12 an:
2011 hatte die Castella GmbH das Zinshaus im zweiten Bezirk gekauft;
vermutlich für Spekulationsgeschäfte.
17 der damals 20 Mieter zogen aus – sie warfen dem neuen Eigentümer Mobbing vor.
Die drei übrig gebliebenen Mieter blieben hartnäckig.
Deshalb haben die Eigentümer (Castella GmbH, Geschäftsführer: Nery Alaev und Avner Motaev) Ende 2011 die Punks ins Haus geladen.
Und das zu besten Konditionen: Sie zahlten eine symbolische Monatsmiete über einen Euro.
„Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los:“
Doch die Punks solidarisierten sich mit den Bewohnern.
Im Sommer 2012 lief der Vertrag der Anarchos mit der Castella GmbH aus, eine Räumungsklage wurde eingebracht und ging bei Gericht durch. Der erste Versuch einer Räumung wenig später scheiterte aber am Widerstand der Bewohner. Seither ist das Haus besetzt.
Hinter der Castella GmbH stecken die beiden Unternehmer Nery Alaev und Avner Motaev, die in Wien über eine Vielzahl von Firmen mehrere Immobilien besitzen.
Insgesamt dokumentierte damals das Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) 16 Zinshäuser im Eigentum der beiden Geschäftsleute, in denen es zu massiven Problemen gekommen war.
Hausräumung könnte rund 700.000 Euro kosten
Ein kreisender Polizeihubschrauber, Panzer, Wasserwerfer und Polizisten aus den Bundesländern, die die Wiener Kollegen unterstützten. Wie viele genau, darüber schweigt die Polizei. "Nicht weniger als 1000", sagte Polizei-Sprecher Roman Hahslinger. Bis zu 1200 dürften es tatsächlich sein. Die Räumung des Mietshauses in der Mühlfeldgasse 12 in Wien-Leopoldstadt mit 50 Punks war jedenfalls eine teure Angelegenheit. Wie teuer, wird sich erst herausstellen. Dennoch: Der Versuch eines Vergleiches mit den bekannten Kosten beim Akademikerball-Einsatz im vergangenen Jänner.
Beim Akademikerball waren 2000 Polizisten zum Schutz der 1500 Ballgäste vor Ort. Die (Überstunden-) Kosten betrugen pro Polizisten durchschnittlich 300 Euro. Die Demo dauerte bis tief in die Nacht. Unterm Strich bedeutete das 600.000 Euro Personalkosten. Bei einer Annahme von 1000 Beamten in der Mühlfeldgasse wären es 300.000 Euro.
Schon beim Akademikerball war die Exekutive mit Hubschrauber und Spezialfahrzeugen im Einsatz. 400.000 Euro sollen die Kosten dafür betragen haben – die Ausrüstung war auch diesmal ähnlich. Grob gerechnet: Der Akademikerball-Einsatz kostete etwa eine Million Euro, die Hausräumung könnte also rund 700.000 Euro kosten.
Quelle: Kurier, 28.07.2014
Als Steuerzahler erwarte ich mir eine substanzielle Beteiligung der Castella GmbH an den Kosten der Räumungsaktion, denn immerhin hat diese die nunmehrigen Besetzer in das Obkekt eingeladen, um damit den hartnäckigen Rest an Altmietern zu vertreiben. Also jene, die die Castella GmbH mit illegalen Aktionen wie Gas abdrehen, Wasserüberflutungen, Tür zumauern, uvam nicht loswerden konnte.
Ach ja, da wäre noch eine Frage:
Wer schützt eigentlich die Mieter in Ojekten die "bestandsfrei" gemacht werden sollen?
Die Gerichte scheinen es nicht zu sein, wie das Räumungsurteil zu belegen scheint.
Berichterstattung wie sie excellent ist!
Der Standard: Wien: Polizei räumt "Pizzeria Anarchia" - Hausbesetzer stellen sich dem entgegen -
2014-07-28 
Die Zauberlehrlinge im 2ten kosten uns wahrscheinlich über 600.000 €! -
Mit einem neuen Hauseigentümer fing die Geschichte in der Mühlfeldgasse 12 an:
2011 hatte die Castella GmbH das Zinshaus im zweiten Bezirk gekauft;
vermutlich für Spekulationsgeschäfte.
17 der damals 20 Mieter zogen aus – sie warfen dem neuen Eigentümer Mobbing vor.
Die drei übrig gebliebenen Mieter blieben hartnäckig.
Deshalb haben die Eigentümer (Castella GmbH, Geschäftsführer: Nery Alaev und Avner Motaev) Ende 2011 die Punks ins Haus geladen.
Und das zu besten Konditionen: Sie zahlten eine symbolische Monatsmiete über einen Euro.
„Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los:“
Doch die Punks solidarisierten sich mit den Bewohnern.
Im Sommer 2012 lief der Vertrag der Anarchos mit der Castella GmbH aus, eine Räumungsklage wurde eingebracht und ging bei Gericht durch. Der erste Versuch einer Räumung wenig später scheiterte aber am Widerstand der Bewohner. Seither ist das Haus besetzt.
Hinter der Castella GmbH stecken die beiden Unternehmer Nery Alaev und Avner Motaev, die in Wien über eine Vielzahl von Firmen mehrere Immobilien besitzen.
Insgesamt dokumentierte damals das Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) 16 Zinshäuser im Eigentum der beiden Geschäftsleute, in denen es zu massiven Problemen gekommen war.
Hausräumung könnte rund 700.000 Euro kosten
Ein kreisender Polizeihubschrauber, Panzer, Wasserwerfer und Polizisten aus den Bundesländern, die die Wiener Kollegen unterstützten. Wie viele genau, darüber schweigt die Polizei. "Nicht weniger als 1000", sagte Polizei-Sprecher Roman Hahslinger. Bis zu 1200 dürften es tatsächlich sein. Die Räumung des Mietshauses in der Mühlfeldgasse 12 in Wien-Leopoldstadt mit 50 Punks war jedenfalls eine teure Angelegenheit. Wie teuer, wird sich erst herausstellen. Dennoch: Der Versuch eines Vergleiches mit den bekannten Kosten beim Akademikerball-Einsatz im vergangenen Jänner.
Beim Akademikerball waren 2000 Polizisten zum Schutz der 1500 Ballgäste vor Ort. Die (Überstunden-) Kosten betrugen pro Polizisten durchschnittlich 300 Euro. Die Demo dauerte bis tief in die Nacht. Unterm Strich bedeutete das 600.000 Euro Personalkosten. Bei einer Annahme von 1000 Beamten in der Mühlfeldgasse wären es 300.000 Euro.
Schon beim Akademikerball war die Exekutive mit Hubschrauber und Spezialfahrzeugen im Einsatz. 400.000 Euro sollen die Kosten dafür betragen haben – die Ausrüstung war auch diesmal ähnlich. Grob gerechnet: Der Akademikerball-Einsatz kostete etwa eine Million Euro, die Hausräumung könnte also rund 700.000 Euro kosten.
Quelle: Kurier, 28.07.2014
Als Steuerzahler erwarte ich mir eine substanzielle Beteiligung der Castella GmbH an den Kosten der Räumungsaktion, denn immerhin hat diese die nunmehrigen Besetzer in das Obkekt eingeladen, um damit den hartnäckigen Rest an Altmietern zu vertreiben. Also jene, die die Castella GmbH mit illegalen Aktionen wie Gas abdrehen, Wasserüberflutungen, Tür zumauern, uvam nicht loswerden konnte.
Ach ja, da wäre noch eine Frage:
Wer schützt eigentlich die Mieter in Ojekten die "bestandsfrei" gemacht werden sollen?
Die Gerichte scheinen es nicht zu sein, wie das Räumungsurteil zu belegen scheint.
Berichterstattung wie sie excellent ist!
Der Standard: Wien: Polizei räumt "Pizzeria Anarchia" - Hausbesetzer stellen sich dem entgegen -
2014-07-28 
Sind Gerichte gerecht? -
Mit einem neuen Hauseigentümer fing die Geschichte in der Mühlfeldgasse 12 an:
2011 hatte die Castella GmbH das Zinshaus im zweiten Bezirk gekauft;
vermutlich für Spekulationsgeschäfte.
17 der damals 20 Mieter zogen aus – sie warfen dem neuen Eigentümer Mobbing vor.
Die drei übrig gebliebenen Mieter blieben hartnäckig.
Um das Objekt "bestandsfrei" zu machen, haben die Eigentümer (Castella GmbH, Geschäftsführer: Nery Alaev und Avner Motaev) Ende 2011 die Punks ins Haus geladen. Und das zu besten Konditionen: Sie zahlten eine symbolische Monatsmiete über einen Euro.
Die Mieter "hätten sich überlegen sollen, ob das Haus noch wohnenswert ist im Zuge der Anwesenheit dieser Leute", sagte ein Vertreter von Castella.
Offenbar wendet die Firma systematisch hinterfragenswerte Methoden zur "Bestandsfreimachung" in ihren Immobilien an.
Das Büro von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) dokumentiert 16 Zinshäuser im Eigentum der beiden Geschäftsleute, in denen es zu massiven Problemen gekommen war.
Allerdings ist nicht bekannt, ob gegen diese "massiven Probleme" in irgendeiner Form gerichtlich vorgegangen worden wäre!
Wohl aber ist bekannt, dass 2012 einer Räumungsklage der Castella GmbH stattgegeben wurde, deren Vollstreckung jedoch scheiterte.
Ursprünglich hatte der Eigentümer sogar seinerseits auf Unterstützung durch die Polizei beharrt. Eine Polizeisprecherin sagte dem "Falter": "So wie der Hausbesitzer sich das vorstellt, geht es nicht. Man kann doch nicht einfach die Polizei rufen und sagen: 'Haut mir die Leute raus!'"
Der Eigentümer setzt sich schließlich auf dem Rechtsweg durch, und eine Räumungsklage erlangt im Februar 2014 Rechtskraft.
Knapp ein halbes Jahr danach muss die Polizei auf Befehl das Anliegen der Castella GmbH vollstrecken.
Zur "Unterstützung" der Gerichtsvollzieher erfolgte nun dieser extreme Polizeieinsatz.
Welches Gericht, welche Polizei schützt gemobbte Mieter?
Kaa Zeit, kaa Zeit - wir müssen die Interessen von gewissenlosen Spekulanten schützen ...."
-
2014-07-28 
19 punks und 1.700 Polizisten -
Ein kreisender Polizeihubschrauber, Panzer, Wasserwerfer und Polizisten aus den Bundesländern, die die Wiener Kollegen unterstützten.
KRIEG? Terroristen? WKR-Ball? - Nein, angebliche 50(!!) punks die ein Haus besetzt halten!
Tatsächlich wurden nur 19!! festgenommen.
Wie viele Polizisten genau, darüber schweigt die Polizei. "Nicht weniger als 1000", sagte Polizei-Sprecher Roman Hahslinger. Bis zu 1200 dürften es tatsächlich sein. Die APA spricht von 1.700.
Die Räumung des Mietshauses in der Mühlfeldgasse 12 in Wien-Leopoldstadt mit angeblichen 50 Punks (letztendlich gar nur 19) wird jedenfalls eine teure Angelegenheit.
Der Hauseigentümr - die Castella GmbH - schloß 2011 mit (aus der "Pankahyttn" rekrutierten) punks einen auf 6 Monate befristeten Mietvertrag ("symbolische" Miete: 1,00 € p.m.) ab, der im Juni 2012 abgelaufen ist.
Ziel war es, die Liegenschaft "bestandfrei zu machen", da die 3 verbliebenen Mieter sich hartnäckig - trotz vielfacher Sabotageaktion - weigerten auszuziehen. Die Mieter "hätten sich überlegen sollen, ob das Haus noch wohnenswert ist im Zuge der Anwesenheit dieser Leute", sagte ein Vertreter von Castella.
Eine Räumungsklage erlangte im Februar 2014 Rechtskraft, die nun mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden soll.
Dass man dazu über 1.700 Polizisten, WEGA, Hubschrauber und Panzer benötigt, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Qualität unserer "Ordnungsmächte".
Als Steuerzahler erwarte ich, dass die Kosten (wahrscheinlich über 600.000 €) für diesen Einsatz der Castella GmbH aufgrund ihres "Geschäftsgebahrens" verrechnet wird.
-
2014-07-26 
Dümmer als die Heinisch-Hosek glaubt! -
Viele, die den Lehrberuf ergreifen wollen, scheitern allerdings am Prüfungsfach Deutsch.
An der PH Niederösterreich ist knapp die Hälfte der 500 Bewerber durchgefallen.
Vor allem Fehler in der Rechtschreibung häufen sich, berichtet das Ö1-Morgenjournal. Und die Tendenz ist steigend. "Das Problem Deutsch macht uns wirklich Sorge", sagt der Vorsitzende der Rektorenkonferenz, Erwin Rauscher, gegenüber Ö1.
In Oberösterreich scheiterte jeder fünfte der 600 Bewerber.
Sieben von acht Polizeianwärtern scheiterten beim Test. Nur 199 von 1620 Bewerbern schafften Prüfung - jeder Dritte scheiterte am – nicht sehr schwierigen – schriftlichen Deutsch-Test. Quelle: Kurier, 25.07.2014
Frau Heinisch-Hosek Sie hatten Recht!
Sie brauchen PISA nicht um das Desaster der sozialistischen Bildungspoltik zu beweisen!
Die alltäglichen Beweise sind schlimm genug! -
2014-07-13 
Notverstaatlichung -
Notverstaatlichung

Die Not mit der Notverstaatlichung
"Experte drängt auf Klage: "Bayern haben Österreich gezielt Milliardenkosten umgehängt".
Finanzminister Michael Spindelegger, VP, hat nicht mehr allzu viel Zeit. Bis 31. Dezember 2014 kann die Republik Österreich von der BayernLB die Rückabwicklung der Notverstaatlichung der Hypo Group Alpe Adria (HGAA) gerichtlich einfordern. Schaut derzeit aber nicht danach aus, als ob sich Spindelegger mit den Bayern auch an dieser Front anlegen will. "Wir halten uns eine Irrtumsanfechtung weiter offen", erklärt ein Minister-Sprecher. Denn grundsätzlich sei man weiter an einem Generalvergleich interessiert, um jahrelange juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden."Wann, wenn nicht jetzt. Einvernahmen und Zeugenaussagen bestätigen, dass die Bayern ganz gezielt ihren Ausstieg vorbereitet haben, damit die Republik Österreich Kosten in Milliardenhöhe übernimmt", fordert Leo Chini von der Wiener Wirtschaftsuni. Der Herr Professor, der auch am Bankwesengesetz mitschrieb und ein Gutachten über die Vorzugsaktien-Causa verfasste, beschäftigt sich intensiv mit den Ereignissen vor jener dramatischen Nacht zum 14. Dezember 2009, als die Bayern dem damaligen Finanzminister Josef Pröll, VP, die marode Bankengruppe umhängten.
Chini führt den Polizeibericht im Strafverfahren gegen den ehemaligen Hypo-Chef Klaus Pinkl, Ex-BayernLB-Boss Michael Kemmer und Bayern-Finanzvorstand Stefan Ermisch an. Gegen das Trio wird in Zusammenhang mit der Notverstaatlichtung wegen des Verdachts auf Untreue, Gläubigerbeeinträchtigung und Bilanzfälschung ermittelt. Der Rechnungshof und die Hypo-Untersuchungskommission unter Irmgard Griss prüfen ebenfalls. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Pinkl wurde von Kemmer für den Fall einer mehr als 50-prozentigen Übernahme durch die Republik Österreich ein Sonderbonus zugesichert, zitierte Format einen Sideletter im Arbeitsvertrag. "Eine echte Sauerei", wettert Chini. Der Vertrag ist nämlich mit 27. Mai 2009 datiert. Für Chini ein Nachweis, dass die Bayern bereits sieben Monate vor der Notverstaatlichung damit rechneten, die Bank loszuwerden.
Pinkl, dem die Bayern eine Jahresgage von rund 500.000 Euro samt einem Bonus in derselben Höhe zusicherten, erhielt bei seinem Abgang im April 2010 für knapp zehn Monate Arbeit die horrende Summe von geschätzten 2,9 Millionen Euro. Davon rund 1,9 Millionen für die Ablöse seines Fünf-Jahres-Vertrages, den Rest aus weiteren Ansprüchen. Letztlich bezahlt von den Steuerzahlern, die Bank gehörte ja schon der Republik Österreich. Der neue Aufsichtsrat unter dem ehemaligen ÖVP-Politiker Johannes Ditz hatte sich dabei sogar noch auf einen Kompromiss geeinigt, Pinkl wären laut Arbeitsvertrag 4,5 Millionen Abfertigung zugestanden.
Nur zur Erinnerung: Es geht hier um Österreichs erfolglosesten Banker, der eine Blutspur durch die heimische Kreditwirtschaft zog. Die Kommunalkredit musste unter seinem Aufsichtsratsvorsitz notverstaatlicht werden. Die Volksbanken AG, deren Chef er fünf Jahre lang war, wurde teilverstaatlicht.
2008 wurde die Bayern-Bank heftig von der Finanzkrise gebeutelt und der Freistaat sprang dem Institut mit Kapital bei. Was natürlich ein EU-Beihilfeverfahren zur Folge hatte. Mit der Auflage, das Auslandsgeschäft, vor allem in Osteuropa, herunterzufahren. Am 29. November 2008 beschloss die BayernLB daher, sich vom internationalen Teil der Hypo zu trennen und die Osteuropa-Strategie aufzugeben.
Am 29. Juli 2009 beauftragte die Hypo auf ausdrücklichen Auftrag der Bayern PricewaterhouseCoopers mit einer Sonderprüfung des Kreditportfolios. PWC stellte ein zusätzliches Vorsorgepotenzial von 908 Millionen bis knapp 1,3 Milliarden Euro fest. "Nur drei Monate nach dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Deloitte. Das ist wohl nur vor dem Hintergrund der Ausstiegsentscheidung der Bayern aus dem internationalen Geschäft zu beurteilen", argumentiert Chini.
Auch Josef Pröll muss sich Kritik gefallen lassen. Weil er bei den Verstaatlichungs-Verhandlungen nur den Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, und einige Spitzenbeamte zur Seite hatte, während die Bayern mit Investmentbankern von Morgan Stanley und Top-Anwälten von Freshfields auffuhren. Und weil es schon im September 2009 erste Gespräche zwischen der BayernLB und der Republik Österreich gab. Der Bank fehlten damals Eigenmittel von rund zwei Milliarden Euro, nachdem die Bayern zuvor Geld abgezogen hatten. Pröll könne sich heute nicht auf den Zeitdruck ausreden, "von September bis Dezember kann man eine Bank schon genauer anschauen", meint Chini. Dann hätte man auch erkannt, "dass die ganze Vorgangsweise der Bayern darauf ausgerichtet war, die Bank quasi insolvenzreif darzustellen – was sie allerdings nicht war". Jedenfalls hätte es andere Lösungen gegeben. "Für die Republik Österreich war die Notverstaatlichung die schlechteste Variante, weil die Weiterführung der Bank durch die rigorosen EU-Auflagen blockiert wird." Jede Sanierung einer Bank, die ihre Geschäftstätigkeit zurückfahren bzw. einstellen muss, "ist von Vornherein zum Scheitern verurteilt".
Eine Rückabwicklung des Desasters ist praktisch freilich nur schwer möglich. Da müsste etwa die Abgabe der Österreich-Tochter rückgängig gemacht und der Verkauf des Südosteuropa-Netzes, der knapp vor dem Abschluss steht, gestoppt werden. Weshalb Chini ein internationales Schiedsgerichtsverfahren vorschlägt.Gut lachen haben nur die Anwälte. Rund um die Hypo und die Bayern sind derzeit sechs große Verfahren gerichtsanhängig.
(kurier) Erstellt am 13.07.2014, 08:00 -
2014-07-12 
Lohnsteuer -
Lohnsteuer

Der Diskonter nebenan preist ein Navigationsgerät um 49,99 Euro an. Die wartende Menge kennt ihren Weg. Ganz ohne Navigationsgerät, das sich ohnehin keiner von ihnen leisten kann oder will.
Wer an diesem Tag einer von den zwei Dutzend ist, die lange vor der Öffnungszeit des Sozialsupermarkts des Wiener Hilfswerks in Wien-Neubau in der Schlange steht, darf monatlich nicht mehr als 1090 Euro verdienen. Herr Rabatsch ist einer von ihnen. "Gott sei Dank habe ich genug zum Anziehen. Rauchen ist das einzige Hobby, das ich mir leiste." Dem 68-Jährigen bleiben nach Abzug von Miete, Strom, Gas und Lebensmittelkosten zwischen sieben und 13 Euro pro Tag.
Paare, denen maximal 1636 Euro pro Monat zur Verfügung stehen, dürfen nach Ausstellung eines Einkaufspasses ebenfalls im SOMA einkaufen, was man so zum (Über-)Leben braucht. Brot gibt es gratis.
"Ich habe zwanzig Euro eingesteckt", sagt eine brünette Mitvierzigerin, die lieber anonym bleiben will. Sprechen aber will sie. Ebenso wie ihre Nachbarin und Freundin, die seit eineinhalb Jahren hier einkauft. Frau S.: "Monatlich bekomme ich 813 Euro. 500 Euro gehen für Miete, Strom und Gas weg. Da kann sich jeder ausrechnen, wie viel mir bleibt." Zehn Euro pro Tag. Wenn alles gut geht. Und das tut es "immer irgendwie, weil wir zusammenhelfen", sagt die 66-Jährige, die trotz allem weder auf ihre zwei Katzen noch ihren Hund verzichten will. "Die gehören zu mir, die will ich mir leisten. Da ess’ ich lieber jeden Tag Eiernockerln oder abends halt einmal ein Schmalzbrot." Verhärmt zu sein oder aufzugeben, kommt für die Freundinnen nicht infrage: "Mit 66 Jahren, da fängt doch das Leben an, oder?"
Gemäß einer Studie des Beratungsunternehmens Mercer sind die Kosten für Wohnen, öffentlichen Verkehr, Nahrungsmittel und Kleidung in Wien im Vergleich zu 211 internationalen Metropolen gestiegen – Wien rangiert statt auf dem 48. mittlerweile auf dem 32. Platz. Das bekommt auch Kirsten Hillinger leibhaftig zu spüren.
Die sechsfache Mutter, Jahrgang 1948, ist Mindestpensionistin – sie muss mit etwas weniger als 800 Euro pro Monat auskommen. Nach zwei Schlaganfällen kann sie sich nur im Rollstuhl bewegen, für den Alltag ist sie auf Hilfe angewiesen. "Natürlich hilft da das Pflegegeld, aber allein meine Miete macht knapp 500 Euro aus. Gegen Monatsende habe ich meist keinen Cent mehr. Dann muss ich meine Kinder bitten, mir auszuhelfen. Das ist schrecklich, weil es doch andersrum sein sollte."
Dabei zahlen weder Frau Hillinger noch Frau S. Lohnsteuer – die wird erst ab einem Jahreseinkommen von 11.000 Euro fällig. Experten mahnen daher: Wer über die Steuerreform debattiert, darf die Kleinsteinkommensbezieher nicht vergessen. Doch die Debatte in der Regierung ist festgefahren.
SPÖ und die Gewerkschaft wollen die Lohnsteuer drastisch senken und auch eine Millionärssteuer zur Gegenfinanzierung einführen. Die ÖVP unterstützt die Senkung des Eingangssteuersatzes bei der Lohnsteuer, wettert aber gegen jede Art neuer Vermögensbesteuerung. Diese würde tatsächlich die Steuergewichte in Österreich verschieben, wie die Grafik zeigt. Der Spitzenbeamte und der Architekt zahlen von ihrem laufenden Einkommen sehr viel Steuer und hohe Sozialabgaben. Da Vermögen in Österreich aber kaum besteuert wird, sinkt ihre Belastung im Verhältnis zum Gesamtbesitz dramatisch.
Aber auch die Reichen könnten von einer Steuerreform profitieren. Geht es nach Teilen der ÖVP, könnte die Grenze für den Höchststeuersatz von derzeit 50.000 auf 100.000 Euro angehoben werden. Der Spitzensteuersatz würde also wesentlich später greifen.
Wer es in Sachen Steuern genau wissen will, schaut sich das Projekt von respekt.net- Gründer Martin Winkler an. Er will eine Steuerpolitik, die auf Daten und Fakten beruht und hat eine Datenbank ins Leben gerufen, wo Menschen anonym ihre Finanzsituation eintragen und auswerten können. Winkler: "Wer über Steuergerechtigkeit diskutieren will, muss erst einmal wissen, wie viele Steuern er überhaupt zahlt. Um sich in seiner Erwerbsgruppe vergleichen zu können, reicht nicht nur das Einkommen als Parameter, sondern müssen alle Abgaben und Steuern miteingerechnet werden. Das ist das Ziel von respekt.net."Wie wichtig der Bevölkerung die Diskussion über eine Steuerreform ist, zeigt die ÖGB-Kampagne (www.lohnsteuer-runter.at), die nach einer Woche fast 100.000 Menschen unterschrieben haben.
Grafik
Ungleiche Verteilung von Steuern und Abgaben
Wie Lohnsteuer, Sozialversicherung, Mehrwertsteuer & Co. besonders geringe Einkommen auffressen.
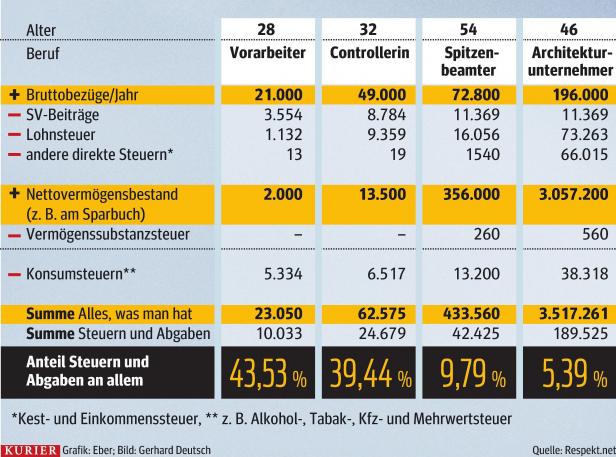 (kurier) Erstellt am 12.07.2014, 19:00
(kurier) Erstellt am 12.07.2014, 19:00 -
2014-07-11 
19.000 € für Vassilakous MigrationsRadlerInnen -
Zum Originalartikel, bzw. ins Archiv
<-- -->
-->
("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2014)Grün-Politikerin Vassilakou:
19.000 € für „mehr Lebensfreude“
In Wien explodieren Arbeitslosigkeit, Schulden und Wohnungsnot – und Frau Vassilakou bringt mit Steuergeld Migrantinnen das Radfahren bei. Wirklich.ökonomischer Wahnsinn. Wir verstehen das - und sehen es anders.
Christian Ortner (Die Presse)
Es war vermutlich eines der schrecklichsten Probleme, unter denen die Stadt Wien in den vergangenen Jahren leiden musste: Die Anzahl der im Weichbild der Donaumetropole sichtbaren Radfahrerinnen mit Migrationshintergrund war erbärmlich gering. Während etwa in Istanbul oder Ankara türkischstämmige Radfahrerinnen nahezu alltäglich sind, waren sie im Wien des beginnenden 21. Jahrhunderts nach Ansicht der rot-grünen Stadtverwaltung unterrepräsentiert, vor allem in Relation zu den vielen autochthonen Bewohnerinnen der Volksrepublik Bobostan, die in Massen mit dem Velo zwischen Bioladen, Yogakurs und „Irgendwas mit Medien“-Workshop hin und her sausen.
Mutig und ohne Rücksicht auf Verluste (vor allem finanzielle des Steuerzahlers) erinnerte sich angesichts dieses unhaltbaren Zustandes die grüne Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou daran, dass es bekanntlich eine der zentralen Funktionen und Aufgaben der Stadt Wien ist, nicht nur für sauberes Trinkwasser und funktionierende Müllabfuhr zu sorgen, sondern auch den Anteil fahrradfahrender Frauen mit Migrationshintergrund zu regulieren. Und schon war 2013 die städtische Initiative „Mama fährt Rad“ ins Leben gerufen, um dieser Verantwortung des Staates für seine Untertanen gerecht zu werden. 33 Frauen wurden Medienberichten zufolge so von der öffentlichen Hand in die Kunst des Radfahrens eingeführt, was sich mit Kosten von knapp 19.000 Euro niederschlug, also 560 Euro pro von der Stadt in den Sattel gehievter Frau. Das ist nicht einmal das Dreifache der Kosten eines entsprechenden Kurses bei privaten Fahrradschulen (rund 200 Euro) und somit für die Verhältnisse der Stadt Wien wirklich „effizient“, wie Frau Vassilakou anmerkte: denn zu erwarten bei einem derartigen Unterfangen der Stadt waren ja eher fünf- bis zehnfache Kosten.
Vom Erfolg sichtlich überwältigt – wer würde das nicht verstehen – meldete die Rathaus-Korrespondenz am Montag Vollzug: „Die Frauen erzählten (. . .), dass sie durch den Radkurs mehr Selbstvertrauen bekommen hätten und dass das gute Verhältnis unter den Frauen gestärkt wurde. Generell bringt der Radkurs den Frauen Lebensfreude.“ – Was, wenn nicht das Herbeiführen von Lebensfreude, Selbstvertrauen und eines guten Verhältnisses zwischen den Frauen, ist denn die zentrale Aufgabe staatlichen Handelns? Nur finstere Reaktionäre werden den völlig veralteten Standpunkt vertreten, das „Herbeiführen von Lebensfreude“ sei eigentlich eine eher private Angelegenheit, die nicht staatlicher Eingriffe bedürfe.
Man könnte die Posse angesichts der für Wiener Verhältnisse geradezu preiswerten Vergeudung von Steuergeld auf sich beruhen lassen, zeigte sie nicht so beispielhaft, was völlig schief läuft in Wien. Während die Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt explodiert – heuer um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr –, die Schulden der Stadt sich seit 2008 von eineinhalb auf fast viereinhalb Milliarden verdreifacht haben und die Zahl der Mindestsicherungsbezieher durch die Decke rauscht, ohne dass dem Rathaus dazu etwas Erwähnenswertes einfiele, versenken komfortabel entlohnte Stadtpolitikerinnen das mühsam verdiente Geld der Steuerzahler in Projekten, die keinen anderen Zweck haben, als das Selbstgefühl der in Wien herrschenden politisch-medialen Clique gut temperiert zu halten – und einer ganzen Cottage-Industrie an Stadt- und parteinahen Vereinen, Projekten und Initiativen zu einem Lebensstandard zu verhelfen, der mit ehrlicher Arbeit nicht annähernd zu erzielen wäre. Wer das Pech hat, nicht Teil dieser mittlerweile üppig dimensionierten Clique direkter und indirekter Profiteure millionenschwerer Subventionen zu sein, darf sich mit dem Gedanken trösten, diesen ganzen Unfug wenigstens als Steuerzahler finanzieren zu dürfen.
Übrigens: ein paar meiner Kumpels, leider Männer, nix Bobo und bar jedes Migrationshintergrundes, würden gerne Harley-Davidsons fahren lernen. Das würde unser „Selbstvertrauen stärken, Lebensfreude herbeiführen“ und „das gute Verhältnis unter uns Männern stärken“. Dafür wird Frau Vassilakou doch sicher auch ein paar Tausender springen lassen, oder? -
2014-07-06 
Die gunfighter -
Schusswaffengebrauch
Kommentar
Warum?
Der Fall eines 21-Jährigen, der von der Polizei erschossen wurde, sollte von der Justiz gut untersucht werden.
Ein 21-Jähriger liegt tot auf der Straße. Er hat eine Tankstelle überfallen. Auf der Flucht wurde er von Polizisten gestellt. Anstatt sich zu ergeben, fuchtelte er mit einer Waffe herum und wurde erschossen.
Wie bei all diesen Fällen stellt sich zunächst die Frage nach dem Warum? Warum wird ein junger Mensch zum Räuber? Bekannte berichten, dass er aus geordneten Verhältnissen stammt und in einer Kleinstadt lebt. Warum musste er sterben, wenn er sich doch auch hätte ergeben können? Noch dazu, wo er nicht einmal eine tödliche Waffe in Händen hielt. Es war „nur“ eine Softgun, mit der er auf Polizisten zielte.
War es Suizid by Cop? Also wollte er angesichts der Aussichtslosigkeit sterben? Hätten die Polizisten nicht auch auf seine Füße zielen oder den Taser einsetzen können? Viele Fragen, auf die es jetzt gilt, die richtigen Antworten zu geben.
Wie auch immer sich der Fall entwickelt - die Justiz wäre gut beraten, diesen Fall nicht nach Monaten zu den Akten zu legen. So wie sie das diese Woche in Wien gemacht hat. Acht tödliche Polizeischüsse auf einen tobenden Wiener beurteilte der Staatsanwalt als Nothilfe. Der Fall landete damit nicht vor Gericht.
Dabei hätte sowohl der Freispruch durch einen Richter mehr Gewicht und auch restlos Klarheit geschaffen, sowohl für die Hinterbliebenen als auch für die Polizisten.
- Zum Autoren-Profil
-
Chronologie
Tödliche Schusswaffeneinsätze der Polizei
Polizisten oft in Notwehrsituationen.
Der Schusswaffengebrauch ist für Polizisten immer eine Gratwanderung. Er gilt als letztes Mittel, Randalierer oder Gewalttäter zu stoppen. Nachfolgend eine Auflistung derartiger Einsätze mit tödlichem Ausgang. Häufig wurden die Beamten selbst durch Waffen bedroht.
7. Juni 2013: Ein tobender Mann attackiert in einem engen Stiegenhaus in Liesing acht Angehörige der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) mit einem Messer. Vier der Polizisten geben insgesamt 20 Schüsse ab. Das Verfahren gegen die Beamten wird ein Jahr später eingestellt.
28. April 2010: Ein 84-jähriger Mann in Laakirchen (Bezirk Gmunden) bedroht in den Nachtstunden einen Zeitungsausträger, der in seiner Hauseinfahrt stehen bleibt, mit einer Pistole. Der Autofahrer flüchtet zur Polizei, die den Senior aufsucht. Nachdem der Mann sich auch nach einem Warnschuss weigert, die Pistole fallen zu lassen, eröffnen die Streifenbeamten das Feuer. Ein Schuss trifft den 84-Jährigen in die Brust.
31. Dezember 2009: Nach einem Überfall auf ein Wettcafe bei Graz wird der Räuber während der Verfolgungsjagd von zwei Projektilen in den Bauch getroffen. Der 38-Jährige durchbricht mit seinem Pkw zuvor mehrere Polizeisperren, in Weitendorf stoppt ein Schuss in den Reifen seine Weiterfahrt. Der Mann steigt aus und eröffnet das Feuer - zwei Polizisten geben daraufhin vier Schüsse ab. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass der 38-Jährige nur mit einer Gaspistole bewaffnet war. Der Verletzte stirbt im Spital an inneren Blutungen.
22. November 2009: Ein Polizist tötet in einer Notwehrsituation einen Lebensmüden in Wien-Favoriten. Der 31-Jährige hat eine täuschend echt aussehende Gaspistole auf den Beamten gerichtet, dieser schießt und trifft den Mann zweimal.
5. August 2009: Bei einem Einbruch in einen Merkur-Markt in Krems a.d. Donau wird ein 14-jähriger Jugendlicher von der Polizei erschossen, sein zum damaligen Zeitpunkt 16-jähriger Komplize schwer verletzt. In der Folge wird über die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs heftig diskutiert. Ein Beamter wird rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen verurteilt.
8. August 2008: Ein Polizist erschießt gegen 4.00 Uhr in Wetzelsdorf (Bezirk Korneuburg) einen Motorraddieb. Der 46-Jährige wollte bei einem Anhalteversuch davonrasen.
19. April 2008: Auf einem Parkplatz der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) in Schwechat kommt bei einem Schusswechsel ein als Polizist getarnter Rumäne durch das Projektil einer Dienstwaffe eines Beamten in Zivil ums Leben. Laut Polizei war der Flüchtende, der gemeinsam mit zwei Komplizen mehrere Überfälle begangen haben soll, auf die Beamten losgefahren. Die Anklagebehörde kommt zu dem Schluss, dass die Schussabgabe durch die Polizisten gerechtfertigt war.
(KURIER) Erstellt am 04.07.2014, 07:03
-
2014-06-26 
Die feine Dame Rauch-Kallat und der Schließmuskel -
Große Tochter?
Die von Philipp Wilhelmer - kurioserweise - als "Doyenne" der konservativen(?) Frauenpolitik bezeichnet wird, also die ehemalige MinisterIN für Bildung, Gesundheit und Frauen, gräflich verehelicht und die den Namen ihres Gespons (zu Recht oder aus Vor-/Rücksicht?) nicht in ihrem Namen führen will, hat uns deutlich gezeigt was eine große Tochter an Bildung und Erziehung zu bieten hat - NICHTS!
Von den anderen "großen Töchtern" in Ministerämtern, deren positive Leistungen man auf einer Briefmarke auflisten könnte, unterscheidet sie sich nur dadurch, dass sie offensichtlich im Galopp durch die Kinderstube geritten ist.
Gabaliers Schließmuskel und seine ehemaligen Windeln haben in einer Diskussion im öffentlich-rechtlichen TV nichts verloren. Diese Aussage zeugt von derartiger Unsachlichkeit und Argumentationsarmut, mit der den Frauen sicher nicht geholfen ist.
Gedankenexperiment:
Ein männliches Wesen argumentierte mit dem Schließmuskel und den Windeln von Frau Rauch-Kallat - der Aufschrei der Allmachtsfeministinnen füllte nicht nur ein Sommerloch!
Danke Frau Rauch-Kallat, sie haben den wirklich großen Töchtern des Landes und einer ernsthaften Frauenpolitik einen Bärendienst erwiesen!
-
2014-06-26 
Wilhelmer, das Neandertal und der Schließmuskel -
Neues aus dem Neandertal
Sehr geehrter Herr Wilhelmer,
Doyen oder Doyenne sind - lt. Duden - dienstälteste diplomatische Vertreter und meist Sprecher eines diplomatischen Korps oder an österreichischen Theatern eine Ehrenauszeichnung für meistens die dienstältesten Ensemblemitglieder.
Frau Rauch-Kallat als "Doyenne" zu bezeichnen ist uncharmant - wegen "dienstälteste" - und sachlich unrichtig. Sie ist schwerlich als diplomatisch zu erkennen und auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten konnten bisher kaum für einen Ehrentitel reichen.
Sie hat - im Gegensatz zu Ihrer Meinung - zumindest das "Schrille" von Frauenpolitikern gezeigt.
Vergleiche "Sicherheitsgurt - Hymnentext - Schließmuskel" hinken nicht, sie sind bewegungsunfähig und schrill - nicht einleuchtend (wie Sie meinen)!
Der von Ihnen akklamierte Sager über Gabalier's Schließmuskel ist beleidigend, unsachlich und hat in einer TV-Diskussion nichts verloren.
Die Kinderstube der von Ihnen ernannten "Doyenne" lässt hier sehr zu wünschen übrig.
Wenn Ihnen so etwas gefällt, dann frage ich mich: wieso sind SIe in einem Kulturressort?
Sie haben völlig recht:
Die Neandertaler sind offenbar noch unter uns.
Und manche glauben schreiben zu können.
P.s:. Wenn Ihr Bild im Kurier noch aktuell ist, scheint es frivol sich über die "Kammfrisur" von Gabalier zu äussern :-) -
2014-06-19 
Straft die "Millionäre!" - Neid ist geil! -
Laut OGM-Umfrage (796 Befragte) sind 55% der Befragten (also 438) für eine "sofortige" Steuersenkung und für die Finanzierung dieser durch eine "Millionärssteuer".
Damit hat die Front der Linkspopulisten, verstärkt durch die "die größte Kampagne aller Zeiten" des ÖGB, Rückenwind für die kurzsichtigste Massnahme aller Zeiten!
Der Kanzler grinst und ist erfreut
Wahrscheinlich freut er sich darüber, dass sich viele, der vom Neid-Reflex Getriebenen, gar nicht bewußt sind, wie nahe sie der Zahlung von "Millionärssteuern" sind.
Eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim, dazu ein paar Wertpapiere oder Sparbücher und schon ist man Millionär und darf "Millionärssteuer" zahlen!
Und auch der Vizekanzler grinst und ist erfreut!
- er wird ja zum Bruch seines Versprechens keine neuen Steuern "gezwungen" und
- er bekommt mehr Geld, wenn auch vom "zu schützenden Mittelstand"
Und schuld ist wieder das Volk, auf dessen - manipulierte - Meinung man zu hören vorgibt, statt zu regieren!
Die Laienspielgruppe auf der Regierungsbank sollte endlich REGIEREN statt den Zurufen von Verbänden, Kammern und Landesfürsten nachzuhorchen!
Tatsächlich tut SPAREN not.
ZEHN (!) Jahre lang hat die Laienspielgruppe Reformvorschläge von Franz Fiedler ignoriert, die 3-5 Milliarden p.a. einbringen könnten.
Experten meinen, dass Substanzssteuern unfair und volkswirtschaftlich schädigend sind und befürworten daher Steuern auf (Bar-)Kapital, monetären Kapitalzuwachs und Kapitalerträge sowie Steuern auf monetären Kapitaltransfer. Dies brächte laufende Steuereinnahmen und gefährdet nicht die Substanz des (Volks-)Vermögens!
Dazu aber müßte man RE(A)GIEREN und sich gegen Landeskaiser, gerettete Banken, Kammmern, Verbände, Bünde, ..... durchsetzen!!
Geht aber nicht!
Weil eben Laienspielgruppe - dilettantisch, profil- und mutlos!
DANKE - sagen alle zukünftigen "Millionärssteuer"-Zahler aus dem Mittelstand! -
2014-06-19 
EIGENVERANTWORTLICH Motorradfahren!" -
<--
 -->
Derzeit sind knapp 430.000 Motorräder in Österreich zugelassen – um fast 50 Prozent mehr als noch 2002, damals waren es 292.000“, erklärt der Ober-Statistiker Bruckner.
Etwa ein Drittel aller schweren Motorradunfälle sind Alleinunfälle ohne Zweitbeteiligten. Diese Crashs sind häufig auf überhöhte Geschwindigkeit oder Fahrfehler zurückzuführen sind. Viele Motorradfahrer werden laut Bruckner aber auch von anderen Verkehrsteilnehmern – meist bei Kreuzungsunfällen – einfach „übersehen“. Bei diesen Kollisionen sind die Pkw-Lenker in der Hälfte der Fälle zumindest mitschuldig, wobei vor allem der Vorrang missachtet wird,
Otmar Bruckner. Er ist Chef-Statistiker des Innenministeriums.
-->
Derzeit sind knapp 430.000 Motorräder in Österreich zugelassen – um fast 50 Prozent mehr als noch 2002, damals waren es 292.000“, erklärt der Ober-Statistiker Bruckner.
Etwa ein Drittel aller schweren Motorradunfälle sind Alleinunfälle ohne Zweitbeteiligten. Diese Crashs sind häufig auf überhöhte Geschwindigkeit oder Fahrfehler zurückzuführen sind. Viele Motorradfahrer werden laut Bruckner aber auch von anderen Verkehrsteilnehmern – meist bei Kreuzungsunfällen – einfach „übersehen“. Bei diesen Kollisionen sind die Pkw-Lenker in der Hälfte der Fälle zumindest mitschuldig, wobei vor allem der Vorrang missachtet wird,
Otmar Bruckner. Er ist Chef-Statistiker des Innenministeriums.
Motorrad-Ausbildung wird deutlich teurerMehr Fahrstunden auf gefährlichen Strecken. Experten rechnen mit 500 Euro Mehrkosten.
Motorrad-Ausbildung wird deutlich teurerNeun tote Biker am Pfingstwochenende waren Ministerin Bures zu viel. Gehandelt wurde prompt (der KURIER berichtete) und ein Expertengremium entschied folgende Schritte: Tempolimits, Verschärfung der Ausbildung für den A-Schein und verstärkte Polizeipräsenz. „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir werden die Führerscheinausbildung für Motorradfahrer nachschärfen“, verkündete Bures am Mittwoch. Noch in diesem Sommer wird sie einen Gesetzesvorschlag präsentieren.
Tempolimits auf Biker-Hotspots
Neben den langfristigen Plänen gibt es auch Sofortmaßnahmen. Die Polizei hat zugesagt, die gefährlichsten Strecken ab jetzt stärker zu kontrollieren. Außerdem sollen Tempolimits an Wochenenden herabgesetzt werden. „Ein erfahrener Biker weiß, dass man in bestimmten Kurven nur 60 km/h fahren darf, auch wenn es ein 80 km/h Limit gibt. Das Problem sind Anfänger, Wiedereinsteiger und Spätberufene, die noch kein Gefühl für die Geschwindigkeit haben“, erklärt Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit und Teil des Expertengremiums.
Bei besagten gefährlichen Routen handelt es sich zum Leidwesen der Motorradfahrer aber meist um die beliebtesten Wochenendziele der Zweirad-Fans. „Die Kalte Kuchl in Niederösterreich ist ein perfektes Beispiel“, sagt Thann. Dort könnten die Motoren also in Zukunft leiser heulen. NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll hat die Bezirkshauptmannschaften bereits beauftragt, ein besonders Augenmerk auf die beliebten Ausflugsrouten zu richten.
Die Unfallanalysen von Pfingsten dürften im Verkehrsministerium zu der Einsicht geführt haben, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Die Hauptunfallursachen waren nämlich ungepasste Geschwindigkeit, Fahrfehler, Unachtsamkeit und riskante Überholmanöver.
Teuerung für Spätberufene
In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Motorradfahrer um ganze 50 Prozent an. Viele der Neulinge sind über 39 Jahre alt und machen den A-Schein erst, wenn sie das nötige Kleingeld dazu haben. „Wer sich eine Maschine um 20.000 Euro leisten kann, dem dürften zusätzliche Fahrstunden um 500 Euro nichts ausmachen“, sagt Thann weiter.
Das Ministerium hält sich mit genauen Angaben um den neuen A-Schein noch zurück. Einigkeit besteht aber darin, dass die Praxisstunden erheblich aufgestockt werden müssen. Es bringt jedoch nichts, die Fahrstunden in der Stadt abzuhalten. Die zusätzlichen Einheiten sollen auf gefährlichen Streckenabschnitten absolviert werden.
Ein Problem, an dem man im Ministerium noch nagt, ist die Kontrolle der Wiedereinsteiger – also jener die den A-Schein in jungen Jahren gemacht haben, sich aber erst viele Jahre später wieder auf die Maschine schwingen. „Wir können nicht kontrollieren, wie oft jemand Motorrad fährt. Aber wir überlegen, ob Menschen, die sich ab 39 Jahren ein Motorrad kaufen, überprüft werden und dann eine zusätzliche Ausbildung machen müssen“, sagt Marianne Lackner, Sprecherin des Verkehrsministeriums.
Neben den Einschränkungen beim „Easy Riding“ gibt es vom Ministerium auch ein kleines Geschenk. Die Aktion, bei der Motorradfahrer einen 20-Euro-Bonus für ein Fahrtechniktraining geschenkt bekommen, wird nämlich bis Ende Juli verlängert.
(KURIER) ERSTELLT AM 18.06.2014, 11:50 -
2014-06-17 
JOB = sinnhafte Aufgabe? -
<--
 -->Innenministerin Mikl-Leitner sprach auch ein – zwischen ihr und Infrastrukturministerin Doris Bures (SP) – heiß diskutiertes Thema an: Mitarbeiter von Post, Telekom und ÖBB, die keine Aufgaben mehr in ihren Konzernen vorfinden, sollen in der Polizeiverwaltung angesiedelt werden. Bures’ Konter vergangene Woche dazu: „Diese Arbeitnehmer haben aber alle einen Job.“
-->Innenministerin Mikl-Leitner sprach auch ein – zwischen ihr und Infrastrukturministerin Doris Bures (SP) – heiß diskutiertes Thema an: Mitarbeiter von Post, Telekom und ÖBB, die keine Aufgaben mehr in ihren Konzernen vorfinden, sollen in der Polizeiverwaltung angesiedelt werden. Bures’ Konter vergangene Woche dazu: „Diese Arbeitnehmer haben aber alle einen Job.“
-
2014-06-05 
Demokratie in Gefahr! - 20 (!!) Burschen demonstrieren! -
 -->
-->
Ein trauriges Jubiläum!KURIER) ERSTELLT AM 02.06.2014, 15:09
ie Wiener Innenstadt wird am Mittwoch erneut zum Hotspot. Burschenschafter marschieren durch die Innenstadt – dagegen wiederum protestieren die Linken. Und das führt zu starken Verkehrsbehinderungen in der City.Sperren und Öffi-Einschränkungen
Ab etwa 17 Uhr wird der Ring zwischen Schottengasse und Schwarzenbergplatz gesperrt. Dazu kommen Einschränkungen bei den Öffis. Ab 16 Uhr werden die Citybusse1a, 2a und 3a eingestellt, die Ringtram ab 16.30 Uhr. Dieweiteren Straßenbahnen am Ring werden ab 17 Uhr kurzgeführt.
Insgesamt zehn Kundgebungen
Insgesamt sind zehn Kundgebungen an dem Tag geplant – neun davon von linker Seite. Für die Polizei wird das ein Großkampftag. Rund 1000 Beamte sind im Einsatz. „Es werden auch Kräfte aus den Bundesländern kommen“, sagt Polizeisprecher Johann Golob. „Wir setzen auf Deeskalation. Aber wir kalkulieren auch damit, dass es unverbesserliche, gewaltbereite Gruppierungen geben wird.“ Das Bündnis NOWKR kündigte schon im Vorfeld an, die Veranstaltung der Rechten „mit allen Mitteln“ verhindern zu wollen.
Auslöser für die Proteste ist eine Podiumsdiskussion im Palais Palffy um 19 Uhr, der vom Verein „Forschungsgesellschaft Revolutionsjahr 1848“ veranstaltet wird. Unter anderem wird der ehemalige Dritte Nationalratspräsident Wilhelm Brauneder (FPÖ) am Podium sitzen. Im Rahmen der Veranstaltung ist auch ein Marsch vom Josefsplatz über die Herrengasse zum Palais Niederösterreich geplant. Dagegen setzt sich die „Initiative gegen Rechts“ in Bewegung. Sie startet bei der Uni, geht über den Ring zum Schwarzenbergplatz und weiter zum Stephansplatz.
Bereits um 11 Uhr ruft das Bündnis NOWKR zu einer Standkundgebung vor der Uni auf.
(KURIER) ERSTELLT AM 04.06.2014, 13:54
Eier und Klopapierrollen flogen am Mittwochvormittag vor der Wiener Universität – ein erstes Geplänkel vor den eigentlichen Protestveranstaltungen und Mahnwachen am Abend. Grund war eine Podiumsdiskussion von Burschenschaftern am Abend im Wiener Palais Palffy in der Wiener City.
Unter dem Motto „Fest der Freiheit“ wollten die Burschenschaften an das Revolutionsjahr 1848 erinnern. Das linke Bündnis „NOWKR“ rief um 11 Uhr zur ersten antifaschistischen Veranstaltung, 150 Unterstützer kamen.
 Organisator Peter Krüger - Foto: APA/HANS PUNZ
Organisator Peter Krüger - Foto: APA/HANS PUNZ
Vor der Universität – wo sich jeden Mittwoch eigentlich die Burschenschafter treffen – war eine Bühne aufgebaut und eine Band spielte. Ein junger Mann mit einer Sturmhaube eröffnete den Demo-Reigen mit einer Rede. Gegen 11.30 Uhr formierten sich dann rund 100 Polizisten mit Schilden gegenüber den linken Demonstranten. Hinter der Polizeisperre versammelten sich um die 20 Burschenschafter.
Am Abend fanden dann gleich mehrere Kundgebungen statt. Insgesamt waren mehr als 1000 Polizisten im Einsatz, darunter auch Beamte aus dem Burgenland, der Steiermark, OÖ und Tirol. Die Kosten des Großeinsatzes belaufen sich auf rund eine Million Euro.
 Die ersten Teilnehmer der Podiumsdiskussion treffen ein - Foto: APA/HANS PUNZ
Die ersten Teilnehmer der Podiumsdiskussion treffen ein - Foto: APA/HANS PUNZ
„Burschis umzingeln“
Unter dem Motto „Burschis umzingeln“ rief die „Offensive gegen Rechts“ zu Demos auf. Die Route führte über den Ring und durch die City. Für den selben Zeitraum hatten die Burschenschafter eine Demo beim Josefsplatz angemeldet. Der Marsch fand letztlich aber nicht statt, er war nur angemeldet worden, um für sicheres Geleit für die Gäste der Veranstaltung zu sorgen, wie Organisator Peter Krüger einräumte.
Mehr Bilder von den Demos:
VOLLBILD-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
![KURIER/Michaela Reibenwein]() KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein -
![KURIER/Michaela Reibenwein]() KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein -
![KURIER/Michaela Reibenwein]() KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein -
![APA/HERBERT P. OCZERET]() APA/HERBERT P. OCZERET
APA/HERBERT P. OCZERET -
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
Kurier/Seiser
-
![Michaela Reibenwein]() Michaela Reibenwein
Michaela Reibenwein -
![APA/HERBERT P. OCZERET]() APA/HERBERT P. OCZERET
APA/HERBERT P. OCZERET
„Fasching ist vorbei“
Mehr als 1000 Antifa-Demonstranten waren ab 18 Uhr auf der Ringstraße unterwegs. Mit Transparenten wie „Fasching ist vorbei“ protestierten sie gegen die Burschenschafter. Bei deren gleichzeitig stattfindenden Podiumsdiskussion mit dem ehemaligen dritten Nationalratspräsidenten Wilhelm Brauneder (FPÖ) wurden lediglich rund 120 Gäste gezählt.
 Foto: APA/HERBERT P. OCZERET
Foto: APA/HERBERT P. OCZERET
-
-
2014-05-27 
Neue Steuern wozu? - Hört nach 10 Jahren endlich auf Franz Fiedler! -
Ein trauriges Jubiläum!
Ex-Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler hat vor zehn Jahren (als Leiter des Österreich-Konvents) Vorschläge für eine tief greifende Verwaltungsreform vorgelegt. Details in der Artikel-Datenbank
Was ist bis jetzt geschehen? Wenig bis NIX!
In einem neuerlichen Vorstoss präsentiert er
- die alten Hüte, die dann wirksam wären, wenn man sie aufsetzte - und meint:
Die Regierung könnte jährlich 3 bis 5 Milliarden sparen und
die Steuerreform mit (längst fälligen) Verwaltungsreformen finanzieren.
Die - wie er meint - nachhaltigen Maßnahmen (im Gegensatz zu Einmaleffekten von Privatisierungen), beschreibt er wie folgt:
Gesundheitsbereich
Vergleichbare Länder geben ca. 9,,0-9,5% des BIP für den Gesundheitsbereich aus.
Österreich 11%! Jedes Prozent bedeutet mehr als drei Milliarden Euro an höheren Kosten.
Die Ursachen dafür liegen u.A. in der Länderkompetenz (z.B. Spitäler zu errichten, auch wenn in unmittelbarer Nähe schon eines steht), bei den Sozialversicherungen (Österreich leistet sich 22!! Sozialversicherungsträger), den unterschiedlichen Interessen von niedergelassenen Ärzten und den Spitälern.
So lange es keine zentrale Stelle gibt, die die Verantwortung über Einnahmen,
Aufgaben und Ausgaben hat, wird das das System nicht kostengünstiger werden.
Schulbereich
Laut Studien versickern jährlich 800 Millionen Euro im Schulwesen, u.A. weil die Kompetenzen auf Bund, Länder, Gemeinden und zusätzliche Verschränkungen verteilt sind.
Auch hier sollte EINE zentrale Stelle im Bund für
einheitliche Regelungen und klare Kostenübersicht sorgen.
Förderungen
Im EU-Schnitt liegen die Förderungen bei 2,5% des BIP
- in Österreich bei 5% = 15 Milliaren Euro!
Zentrale Erfassung gibt es nicht, Doppelförderungen sind häufig und wieder einmal sind die Kompetenzen auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt.
So kann jeder seinem politischen "Freundeskreis" (wie man im ORF charmanterweise die Fraktion neuerdings nennt) Gutes tun und wenn's geht, gleich doppelt!
Und wie immer sind
die Länder gegen eine "Zentralisierung", die erhebliche Einsparungen brächte,
aber die Macht der Pfründevergabe deutlich reduzieren könnte!
Fiedler sagt:"Ich bin nicht gegen neun Bundesländer, nur gegen Strukturen und Bedingungen unseres Föderalismus."
Ich sage: Recht hat er! Vorschlag:
Macht Landtags- und Bundesratsjobs zu Ehrenämtern
dann seid ihr diese Pfündnerbande los und spart zusätzliche Millliarden!
Aber dazu seid ihr zu bequem, zu verhabert und zu feig!
Das Staatsvolk und Wahlvieh dankt - und bezahlt murrend weiter.
-
2014-05-27 
Versagen der Eliten? NEIN, das Verarschen der Eliten! -
Helmut Brandstätter schreibt im Kurier vom 06.05.2014: Wir beobachten das Versagen der Eliten
Wen meint er damit? Wer sind die Versager?
Etwa die fleißig arbeitende Mehrzahl der österreicjischen Bevölkerung?
Oder die leistungsbereiten Menschen in diesem Land?
Das sind doch die wahren Eliten!
Denen kann er doch kaum Versagen attestieren, vielmehr müsste er Erleiden feststellen!
Wenn er aber mit Eliten die wirklichen Versager - unsere "Regierung", die Parlamentarier, die Landesfürsten, die Kammern, den ÖGB .... - meint, dann sollte er im Duden den Wortsinn nachschlagen!
Vielleicht schriebe er dann zutreffendere Titel!
-
2014-05-26 
Steuerreform wozu? Österreich scheint ohnedies reich zu sein! -
Alle reden vom Sparen und Millionärssteuern.
Brauchen wir nicht!
So lange nicht, so lange wir uns z.B. das leisten:
Bruttojahreseinkommen ausgewählter Politiker 2012
Ewald Nowotny € 334.000.- Bernanke (Chef US-Nationalbank)
€ 148.000.-225% Heinz Fischer € 328.000.- Barack Obama € 296.000.- 122% Werner Faymann € 286.000.- Angela Merkel € 217.000.- 131% Alexander Wrabetz € 350.000.- Peter Boudgoust (Chef ARD) € 273.000.- 128% David Brenner Salburger Finanzlandesrat € 196.000.- Tomothy Geithner US Finanzminister)
€ 140.000.-140%
-
2014-05-25 
Wie JEAN CLAUDE JUNCKER wirklich denkt - und uns verarscht: -
Jean-Claude Juncker ist ein pfiffiger Kopf.
"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert", verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert.
"Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wir weiter - Schritt für Schritt,
bis es kein Zurück mehr gibt." Details in der Artikel-Datenbank
Im Mai 2011 erkärt er vor laufender Kamera:
„Ich bin für geheime Debatten unter einigen wenigen verantwortlichen Personen.“
und dann in der FAZ:
„Wenn es ernst wird, muss man lügen.“ Details in der Artikel-Datenbank
Wahrlich ein integrer(?) Mann, den Faymann und Spindelegger als Kommissionspräsidenten sehen wollen -
wahrscheinlich weil sie wie "die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wird" und ausserdem
extrem viel Verständnis für Geheimverhandlungen und Lügen im Ernstfall haben!
-
2014-05-24 
da Dokta Rasinger hot ka Ruderleiberl! -
"Wenn wir uns selbst nicht ernst nehmen, wie soll uns dann die Bevölkerung ernst nehmen?", fragt Erwin Rasinger rhetorisch. lt. Kurier
Die Bevölkerung nimmt euch dann ernst, wenn ihr ernsthafte Arbeit macht!
Das Kasperltheater, das ihr im sog. "Hohen Haus" aufführt hat
- phrasendreschende
- vom Klubzwang gegängelte
- Anwesende in geistiger Abwesenheit
- Hungrige - die wie Sie - im HH essen müssen
- Bildungshungrige - die wie Sie - im HH Zeitung lesen müssen
- Abwesende - weil's im Plenarsaal wieder einmal fad' is
als Hauptdarsteller - aber die meisten - so wie Sie - mit Krawatte!
Sie fordern rhetorische Brillanz beim heisse Luft absondern,
nun das wird die Qualität der Arbeit auch nicht wirklich heben.
Übrigens: Lieber gehe ich zu einem guten Arzt der im Ruderleiberl arbeitet,
als zu einem, der mir mit "rhetorischer Brillanz" und Krawatte nicht helfen kann.
Es wäre besser Faymann und Spindelegger hätten keine Krawatte und würden Sinnvolles tun.
Aber vielleicht sind die Krawatten zu eng gebunden und reduzieren dadurch die Gehirndurchblutung?
Das sollten Sie als Arzt doch feststellen können, wenn Sie nicht gerade den "Parlaments-Elmayer" darstellen.
-
2014-05-21 
Die "Identitären" danken Häupl! -
Feind der Demokratie ist nicht derjenige, der eine bestimmte Meinung vertritt,
sondern derjenige, der andere Meinungen verbieten will!
Es fällt mir auf, dass gerade Linke und Grüne einen zutiefst demokratiefeindlichen Hass gegen Andersdenkende kultivieren und nach Verboten schreien.
Häupl z.B. beweist einmal mehr sein absolutistisches Demokratieverständnis:
"Eine Gruppe wie die Identitären gehört längst politisch verboten.
Das ist eine neofaschistische Organisation, die eigentlich völlig klar unter das Verbotsgesetz fällt".
Mag ja so sein, aber:
Haben Sie, Herr Häupl bereits eine Anzeige gegen die Identitären eingebracht?
Haben Sie, Herr Häupl eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft gerichtet?
Oder sondern Sie im Vorwahlkampf wieder einmal nur populistisch heisse Luft ab?
Die brandgfährliche Massenbewegung von nahezu 100(!) verhaltensauffälligen Menschen mit besonderen Bedürfnissen dankt Ihnen jedenfalls für Ihre kostenlose Werbung!
Ach ja, da hab' ich noch eine Frage:
Wie viele von den 38 Festgenommenen (und mit Steinschleudern, Messern, Totschlägern etc. aufgerüsteten) gehören eigentlich zu den "guten linken Demonstranten (Offensive gegen Rechts)" die nur einen Anti-EU-Protestmarsch von 100 Identitären verhindern wollten?
... und noch 'ne Frage:
Ist - organisierte - Gewaltbereitschaft links, grün oder rechts?
Oder nur undemokratisch?
-
2014-05-20 
Schweren Raub und betrügerische Krida "entkriminalisieren" - HALLO!! Geht's noch??? -
Experten(?) und Praktiker wollen schweren Raub und betrügerische Krida "entkriminalisieren"!
Habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Der unglücklich glückliche Räuber:
Unglück: Das Opfer hat nix oder nur wenig in der Tasche :-(
Glück: ein Jahr Haft (Mindeststrafe), weil "die Beute nur geringen Wert hat und nichts passiert ist"!
Dem Opfer is' eh nix passiert, hod si nur a bissel g'schreckt - haha!
Habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Wenn aber doch etwas passiert - nämlich das Opfer tot ist,
dann nicht mehr lebenslange Haft, sondern ggf. Mordanklage.
Nun gehört zum Delikt Mord der Vorsatz, also
"I hob eahm jo nix tuan wolln, oba er hod si gwehrt,
do is daun da Schuss losganga - i hob's ned woll'n!"
Vermutliches Resultat: Totschlag oder gar vielleicht Unfall!!
Habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Die Strafe für betrügerische Krida soll nach Ansicht von
Höchstrichter(!?!) Schroll und anderen Experten(?) abgemildert werden!
Danke für die Einladung zum Kavaliersdelikt Betrug!
Habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Weil die Gefängnisse ueberlegt sind sollen offenbar eindeutig kriminelle Handlungen einem "Augenzwinkern" beurteilt werden.
Damit die "Freunderln" nicht zu lang sitzen müssen (wenn sie überhaupt 'haftfähig' sind) muss die Haftdauer für Wirtschaftsdelikte in den heutigen "Komfortgefängnissen" verkürzt werden.
Milde Strafen sind die Einladung zum Verbrechen und auch die Einladung von "Kriminaltouristen". DANKE liebe Experten!
Ihr habt offenbar nicht mehr alle Tassen im Schrank!
Wacht doch endlich auf und schützt die Menschen und nicht die Verbrecher!
KURIER-Originalartikel
-
2014-05-19 
Pilnacek & Fuchs - Lobbyisten für Wirtschaftsverbrecher? -
Laut § 153 StGB ist Untreue ein Verbrechen.
Das Strafmaß bei 50.000 Euro übersteigenden Schaden: Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren.
Das ist für den Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, aber auch für Strafrechtsprofessor Helmut Fuchs laut Kurier vom 2014-05-19 überzogen.
Man diskutiert über die Anhebung der Wertgrenze auf das Hundertfache!!
Der Herr Professor wünscht sich mehr Augenmaß bei der Strafbemessung.
Sie haben völlig Recht Herr Professor!
Laut § 201 StGB ist auch Vergewaltigung ein Verbrechen. (Strafmaß: Freiheitsstrafe von ein bis zu zehn Jahre)
Laut § 206, 207 StGB ist auch sexueller Missbrauch von Unmündigen ein Verbrechen (Strafmaß: Freiheitsstrafe von 6 Monate bis zu zehn Jahre)
JA, Sie haben völlig Recht Herr Professor Fuchs!
Das Augenmaß ist WEG!
- wenn ein 15-jähriges Vergewaltigungsopfer ihrem veruteilten Vergewaltiger täglich begegnen muss
- wenn Kindesmisshandler zu lächerlichen Strafen verurteilt werden
- wenn häusliche Gewalt zum Kavaliersdelikt wird und dann doch mit Mord endet!
und die armen Richter mit "schwieriger Beweisbarkeit" konfrontiert sind
und daher die Schuld geringer bewerten!
Wacht doch endlich auf und schützt die Menschen und nicht die Verbrecher!
KURIER-Originalartikel
Kurier-Leitartikel
Interview Fuchs
-
2014-05-12 
Hallo TOM - lass Deine Conchita NICHT vereinnahmen!! -
GRATULATION zum ESC-Sieg!
GRATULATION zu Deiner Schöpfung, Deinem Geschöpf Conchita Wurst!!
GRATULATION zu Deiner Klugheit, Bescheidenheit und Beharrlichkeit!!!
Du bist für mich ein Künstler, der mit Kreativität, Ausdauer und hohem Können endlich den verdienten Erfolg feiern kann!
DU hast - vor allem für DICH - Großartiges geleistet und Dein Traum ist in Erfüllung gegangen!
Und plötzlich bist Du " Königin von Österreich" und "Queen of Europe" - wo doch vor wenigen Tagen noch "viele, die jetzt jubeln, sich jahrelang nur die Papp'n z'rissen ham über'n Tom" (© Hubert Neuper)!
Plötlich sind sie alle da: der Bussibär Fischer, der ewig grinsende Faymann, der moralinsaure Spindi ...... und alle sind stolz auch Dich - sogar der HC hat gratuliert!
Viele werden versuchen Conchita vor ihren Karren zu spannen - vergiss also Deine Worte nicht:
We are a unity and we are unstoppable!
This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom!
Wenn Du so eigenständig, tolerant und warmherzig bleibst wie bisher, werden viele Meschen - so wie ich - ein gutes Stück des Weges zu einer Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Diskriminierung mit Dir gehen und das Gute wird am Ende gewinnen!
-
2014-05-09 
Faymann - Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode! -
Dieses Zitat stammt aus Shakespeares Drama »Hamlet« (II, 2) und trifft in seiner gebräuchliheren Form
»Ist dies schon Wahnsinn, hat es doch Methode« voll auf den situationselastischen Kanzler zu.
Hatte er noch am 24.4.2012 gefordert:
"Der unübersichtliche Stiftungsrat muss ein ordentlicher Aufsichtsrat werden.
Da brauchen wir hoch qualifizierte Leute,
der neue Aufsichtsrat darf höchstens 10 bis 15 Leute umfassen.",
hat er heute eine guten Rat (!?!) für den Stiftungsrat parat:
Eine Reform aus eigener Kraft, innerhalb des ORF-Aufsichtsgremiums.
"Die 35 neuen Stiftungsräte könnten ja aus ihrem Kreis zehn bestellen, und sagen, die zehn sollen die Stiftungsrat-Aufgaben wahrnehmen und der bestehende Stiftungsrat wird eine Art Beirat".
Wahrlich SPARwillig gesprochen lieber Werner, wir wollen doch unsere Parteigenossen nicht verkommen lassen.
Also einen Versorgungsbeirat - so ähnlich wie der Bundesrat!
Grund für die 2 Jahre aufgeschobene Reform: "Dazu müssen wir wohl das Gesetz ändern, sonst hätten wir es ja schon längst gemacht".
Konnten sie aber nicht - Faymann und Spindelegger waren vollzeitig mit der Vertuschung der Hintergründe der HYPO-Affäre beschäftigt.
Daher: Stiftungsrat, mach's dir selbst!
Originalartikel
-
2014-04-24 
Faymann - ein Lügner? -
Ein Mensch, der den Versprechen von Politikern glaubt ist ein Tor!
- hat nix mit Fussball zu tun, es ist ein sehr konservatier Ausdruck für einen einfältigen Menschen ;-)
Ein Mensch der Faymann's Versprechen glaubt, ist etwa so umnachtet, wie Josef Pröll, als dieser die Hypo zurückkaufte.
Am 24.4.2012 sagte Faymann zum KURIER:
"Der unübersichtliche Stiftungsrat muss ein ordentlicher Aufsichtsrat werden.
Da brauchen wir hoch qualifizierte Leute,
der neue Aufsichtsrat darf höchstens 10 bis 15 Leute umfassen."
Exakt heute - 730 Tage danach die folgende Realität:
Der Stiftungsrat besteht - nach wie vor - aus 35 (!!) Mitgliedern.
Neun Mitglieder werden von der Bundesregierung entsandt.
Jedes Bundesland entsendet ein Mitglied.
Sechs Mitglieder werden aus dem Publikumsrat gewählt.
Fünf Mitglieder kommen vom ORF-Zentralbetriebsrat.
Sechs Mitglieder werden von den Parteien im Nationalrat gemäß ihrer Stärke gestellt.
Der Stiftungsrat hat eine Funktionsdauer von vier Jahren. Mitglieder können auch vorzeitig abberufen werden.
Und "entpolitisiert" wurde auch:
Statt vier gibt es jetzt nur mehr drei "Unabhängige" im Stiftungsrat!
Wahrlich, ein wahrhaftiger Mann. der Faymann!
-
2014-04-14 
Neger, Zigeuner & Co. - Ein Leserbrief für UNS alle! -
Im Kurier vom 2014-04-14 schreibt Herr Albrecht Rietsch aus 1220 Wien einen Leserbrief, der mir aus dem Herzen spricht:
Pfuiwörter
Neger(konglomerat) darf man nicht sagen, Eskimo darf man nicht sagen, Zigeuner darf man nicht sagen, Jugo mauch nicht, nur Piefke. Über die darf man sogar eine vierteilige Saga drehen.
Frau Doktor darf man nicht sagen,nur Frau Doktorin (Dr.in), Frau Magister auch nicht (Mag*).
Was ist eigentlich los mit uns?
Eine Minderheit von Linken (Emanzen) sagt uns, welche Wörter schlimme Wörter sind, so wie man ein Kind rügt, dass Scheiße sagt.
Ich, mit jüdischen Vorfahren, glücklich verheiratet mit einer (dunkelhäutigen) Ausländerin, möchte mir nicht dauernd von außen sagen lassen, wie ich mich ausdrücken soll.
Wann werden die selbsternannten Moralhüter begreifen, dass es nicht das WAS, sondern dass es das WIE ist, dass ein Wort zum Schimpfwort macht??
Wenn Herr Mölzer "Schwarzafrikaner" sagt, wird dies wahrscheinlich deutlich abfälliger klingen, als wenn ich "Neger" sage!
Der Philosoph Slavoj Žižek weist - m.E. äusserst zutreffend und wichtig - darauf hin, dass sich „politisch korrekte“ Begriffe abnutzten (die Ersatzbegriffe erben mit der Zeit die Bedeutung des Wortes, das sie ersetzen sollten), wenn sie nicht mit einer Veränderung der sozialen Wirklichkeit einhergingen.
Simon Inou - dessen Meinungen ich nur partiell teilen kann - fordert völlig zu Recht "Respekt, der von innen kommt"!
Nur Respekt erreicht man nicht durch moralisierende Verbote, sondern durch Diskussion, Dialog und Offenheit!
Also: nicht das "N-Wort" verbieten, sondern erklären warum Neger für Afrikaner beleidigend ist!
Weil es mit Unterdrückung, Mord und Sklaverei verbunden ist!
Wenn wir daran denken, werden wir "Neger" vermeiden -
und nicht weil es uns verboten wurde!
-
2014-04-12 
Hypo-Untersuchungskommission: Schmeissen Sie's hin Frau Griss! -
Frau Griss, Sie haben in Österreich keine "Experten" gefunden die
"völlig frei von Verbindungen zur Hypo-Alpa-Adria" sind.
Daher haben Sie vier Experten, zwei Deutsche und zwei Schweizer, bestellt,
die "unabhängig und unbefangen" für Aufklärung sorgen sollen.
Die mangelnde Wahrheitspflicht von Zeugen in der Untersuchungskommossion stellt für Sie kein Problem dar, da Sie aufgrund ihrer Taetigkeit als Richterin beurteilen koennten, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht.
Sie haben die Experten befragt, ob sie "etwas mit der Hypo zu tun hätten" (eine extrem präzise Fragestellung für eine ehemalige Richterin).
Herr Contzen hat nein gesagt und Sie haben das - aufgrund ihrer Taetigkeit als Richterin - als wahr beurteilt.
Herr Contzen war bis vor Kurzem im Verwaltungsrat der Deutsche Bank-Tochterfirma DWS die Anleihen der Hypo in der Höhe von knapp 320 Millionen Euro hält.
No, natürlich hat er nix mit der Hypo zu tun!
Er wird also "unabhängig und unbefangen" für Aufklärung sorgen!
Selbst wenn Sie jetzt Herrn Contzen entlassen sollten
bleiben doch erhebliche Zweifel an Ihrer Fähigkeit zur Beurteilung von wahr und falsch bestehen!
Schmeissen Sie's hin, bevor Sie sich noch weiter blamieren!
P.S: Nachhilfe für Kommissionsvorsitzende:
Contzens curriculum vitae ist, für jedermann der sich für Finanzgeschäfte interessiert bzw. befasst ist, ein offenes Buch.
Wie wär's mit recherchieren statt fragen?
Oder wäre das zu professionell??
-
2014-04-12 
Und wieder ein Finanzminister der klaut! -
Einige seine Vorgänger haben sich durch Steuermanipulationen, fragwürdige Aktiengeschäfte und dubiose Geldtransfers etc. persönlich bereichert und damit dem Steuerzahler und auch Privatpersonen Schaden zugefügt.
Herrn Spindelegger kann man persönliche Bereicherung nicht vorwerfen - dazu ist er nicht smart und auch nicht schön genug.
Aber auch er klaut!
Als Folge seiner extrem unprofessionellen Vorgangsweise in der Hypo-Affäre
klaut er dem Steuerzahler wahrscheinlich € 14 - 16 Mrd und
dem Bildungswesen - das ohnedies schon arg bedient ist - € 110 Mio.
Auch dem maroden Gesundheitssystem stehen Kürzungen bevor.
Weitere "Spar"-Maßnahmen - also neuerlicher Klau zugunsten der Hypo - sind lt. Spindelegger nicht auszuschließen.
Wie lange und wie tief darf er noch in unsere Taschen greifen? -
2014-04-09 
Hypo-Untersuchungskommission: Das Feigenblatt -
Spindelegger hatte eine "Idee" - statt dem gefürchteten U-Ausschuss, den mittlerweile mehr als 130.000 Österreicher fordern - lieber eine zahnlose Untersuchungskommission.
Zur Erinnerung:
Bei einem U-Ausschuss
- stehen Zeugen unter Wahrheitspflicht
- können Zeugen zwangsweise vorgeführt werden
- können Unterlagen und Akten angefordert und eingesehen werden.
Die U-Kommission ist aber auf den good-will der Akteure aus Politik und Wirtschaft angewiesen!
Frau Griss - eine pensionierte Richterin - holt sich 4 Experten aus dem Ausland (in Österreich sind keine "Experten" zu finden, die "völlig frei von Verbindungen zur Hypo-Alpa-Adria" sind), die "absolut unabhängig sind und nie zuvor mit der Hypo beschäftigt waren".
Frau Griss agiert ehrenamtlich, während die "Experten" - Carl Baudenbacher, Manuel Ammann, Claus-Peter Weber, Ernst-Wilhelm Contzen - "marktüblich" bezahlt werden.
Und wer wird für die "marktübliche" Bezahlung zur Kasse gebeten?
Richtig! Wir Steuerzahler!
Danke Herr Finanzminister, sie klauen schon wieder!
Zum Kurier-Artikel, sollte der Artikel nicht mehr online sein, finden Sie ihn in der Artikel-Datenbank
-
2014-04-09 
138.313 haben es getan! UNTERSCHREIBEN AUCH SIE!!! -
138.313 Unterschriften für die Petition, über 200 Demonstranten, bröckelnde Landesregierungen ...
was brauchen diese Heimlichtuer noch?!?
IHRE Unterschrift!
JETZT!
Um es Ihnen leichter zu machen, hier der entsprechende link:
Petition 10 - umfassende Aufklärung des Hypo-Alpe-Adria-Finanzdebakels und
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses
-
2014-04-09 
Hypo-Haeftlinge: Na und ...? -
Wurde wegen Untreue nicht rechtskräftig zu 26 Monaten unbedingter Haft verurteilt: Ex-Hypo Chef Tilo Berlin. - Schaden von 2,573 Mio. Euro
Das Urteil fiel schließlich knapp vor Mitternacht, Berlin nahm es emotionslos zur Kenntnis. Sein Verteidiger Patrick Thun-Hohenstein meldete umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.
GÜNTER STRIEDINGER: Sitzt 4,5 Jahre bereits ab; W. KULTERER: Der Ex-Hypo Chef muss für 6,5 Jahre in Haft. Hat Haftaufschub; HERMANN GABRIEL: Hat Haftunfähigkeit beantragt; GERHARD KUCHER: Hat die vier Jahre Haft angetreten - Foto: APA/GERT EGGENBERGERGerd Xander, sitz in Haft 3,9 JahreNeun Manager verurteilt, aber nur drei in Haft In den zahlreichen Strafverfahren rund um die Kärntner Hypo-Bank gibt es insgesamt zwölf Angeklagte. Neun von ihnen sind rechtskräftig verurteilt. Doch in Haft befinden sich lediglich drei, die Ex-Vorstände Günter Striedinger (zu vier Jahren Haft verurteilt) und Gert Xander (insgesamt drei Jahre und neun Monate) sowie Anwalt Gerhard Kucher (vier Jahre).Noch im April, spätestens Mitte Mai, wird es zu einem "Ansturm" auf die Justizanstalt Klagenfurt kommen. Da läuft der Haftaufschub für Wolfgang Kulterer (hat drei Verurteilungen und insgesamt sechseinhalb Jahre abzusitzen) ab. Allerdings hat sein Anwalt Ferdinand Lanker eine Beschwerde gegen die Ablehnung des Haftaufschubs eingebracht. Sie ist beim OLG Graz anhängig und hat aufschiebende Wirkung. Kulterer gegenüber dem KURIER: "Ich habe am Freitag erst die Nähte von der letzten Schulter-OP, bei der die Schrauben entfernt wurden, gezogen bekommen. Jetzt brauche ich noch eine Physiotherapie, wie lange die dauert weiß ich nicht. Danach trete ich die Haft ganz sicher an, denn eine weitere Verzögerung macht keinen Sinn."
Ex-ÖVP-Chef Josef Martinz (viereinhalb Jahre Haft), Steuerberater Dietrich Birnbacher (sechs Monate) und dem ehemaligen Landesholding-Vorstand Hans-Jörg Megymorez (drei Jahre)wird in diesen Tagen die Aufforderung zum Haftantritt zugestellt. "Jeder ist auch vor Ablauf der Monatsfrist willkommen", hieß es aus Gerichtskreisen. Megymorez will auch so schnell wie möglich die Strafe antreten.
Bei Birnbacher ist zu erwarten, dass er eine Fußfesessel beantragen wird.Obwohl bereits im Juli 2013 rechtskräftig zu viereinhalb Jahre Haft verurteilt, hat auch der Steuerberater Hermann Gabriel seine Strafe noch nicht angetreten. Er hat einen Antrag auf Haftunfähigkeit eingebracht.Heute wird das nächste Urteil gegen einen weiteren prominenten ehemaligen Hypo-Manager fallen. Richter Christian Liebhauser-Karl wird seine Entscheidung im Untreueprozess gegen den ehemaligen Hypo-Vorstand und Investor Tilo Berlin bekannt geben. Berlin war im Gegensatz zu Kulterer im Vorzugsaktien-Prozess bis zum Schluss nicht geständig. -
2014-04-07 
Vorratsdatenspeicherung: 11.139 Sieger haben verloren! -
11.139 österreichische Bürger schlossen sich der Verfassungsbeschwerde des AK Vorrat gegen die verdachtsunabhängige Datenspeicherung an, die in Österreich seit 1. April 2012 in Kraft ist.
Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte entschied der Europäische Gerichtshof und kippt die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung.
Die anlasslose Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten der Bürger zu Fahndungszwecken sei „in vollem Umfang unvereinbar“ mit der EU-Charta der Grundrechte verkündete der Europäische Gerichtshof am 2014-04-08 in Luxemburg.
Grund zum Jubeln? Grosser Sieg? - NEIN! - Es wurde eine Richtlinie gekippt und nicht ein Gesetz!!!
Den Nationalstaaten - somit auch Österreich - bleibt es weiterhin unbenommen per Gesetz Vorratsdatenspeicherung zu betreiben.
In Österreich wurde die Vorratsdatenspeicherung im April 2012 zum Gesetz erhoben und damit sämtliche Telekommunikationsanbieter verpflichtet
alle Kommunikationsvorgänge via Telefon und Handy, E-Mail und Internet sechs Monate langzu speichern. (Stammdaten = Name und Adresse des Benutzers, Handy- und Telefonnummern, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Geräte-Identifikationsnummern von Mobiltelefonen und deren Standortdaten.)
Die Sinnhaftigkeit der Vorratsdatenspeicherung - die ursprünglich mit dem "Kampf gegen den Terror" beargumentiert wurde - zeigt sich in der realen Nutzung:
326 Anfragen und 312 Auskünfte von 2012-04-01 bis 2013-03-31,
in 71 Fällen soll die Vorratsdatenspeicherung einen Beitrag zur Aufklärung geleistet haben.
Auch die "Schwere" der Verbrechen spricht Bände:
Bei den durch mithilfe von Vorratsdaten aufgeklärten Fällen waren 16 Fälle dem Diebstahl zuzuordnen, 12 den Suchtmittel, 12 dem Stalking, 7 dem Betrug und 7 dem Raub.
Von Terrorismus oder Mord - Gott sei Dank - keine Spur!
Alllerdings scheint das Innenministerium keinen Handlungsbedarf zu sehen, Änderungen herbeizuführen.
Verständlich, wenn der US-Geheimdienst NSA die komplette österreichische Telekommunikation überwacht und professionelle Hacker 2013 die Daten von einer halben Milliarde Internet-Nutzer geklaut haben!
Datenschützer sollten also nicht jubeln, auch wenn es den Anschein hat als ob Datenschutz festgeschrieben sei, so lange bis wir vor denen, die wissen, wie man an Daten kommt, nicht geschützt sind! -
2014-03-26 
Heinisch Hosek: Die Würgerin vom Minoritenplatz -
Alles was nach Evaluierung riecht muss abgewürgt werden!
Dies ist die offensichtliche Einstellung unserer sogenannten Bildungsministerin.
In Zeiten wie diesen, wo Datenklau, NSA und Vorratsdatenspeicherung gang und gäbe sind, muten die Absagen aller Bildungstests (PISA, TIMMS, Bildungsstandards) und auch der Evaluierung der NMS äusserst skurril und vordergründig an.
Die Zentralmatura ist plötzlich sicher, alles andere hat ein "Datenleck"?!?
Vergleichende Tests haben die österreichische Bildungspolitik bisher ziemlich alt aussehen lassen, die Angst davor ist ist verständlich - wer lässt sich schon gerne beweisen, was für einen desaströsen Job er - sie - gemacht hat?
Also: ABWÜRGEN! - das hat sie vom Kanzler gelernt,
der würgt ja auch kräftig beim Aabwürgen des U-Ausschusses mit!
-
2014-03-25 
Häupl: Wien ist sicher! Polizei braucht nur 45 Minuten!!! -
In Wien springt ein Pitbull auf einen abgesperrten Kinderspielplatz.
Anrainer bändigen den Pitbull.
Auskunft des Polizei-Notruf: "Lassen Sie den Hund wieder frei." !?!
Nach 17 Notrufen taucht erst nach über 45 Minuten die Polizei auf! - weil angeblich kein Auto verfügbar war!?
Die Polizeireform der Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sei eine Maßnahme, "um mehr Polizisten auf die Straße zu bringen".
Daher soll es in Wien in Zukunft weniger Polizeiinspektionen geben.
Mikl-Leitner:"Sicherheit definiert sich nicht an der Zahl der Polizeiposten, sondern an der Präsenz der Exekutive auf der Straße. - aber offenbar nicht auf einem Kinderspielplatz!
Auf eine KURIER-Anfrage am 06.02.2014 gab die Polizei ihre aktuelle Anfahrtszeit zu den Einsätzen bekannt.
„Im vergangenen Jahr brauchten wir im Schnitt drei Minuten und 50 Sekunden pro Einsatz und Fahrzeug“, so Roman Hahslinger aus dem Pressebüro. In Zukunft sollen sich auch nach eventuellen Wachzimmer-Fusionen die Anfahrtszeiten unter Blaulicht und Folgetonhorn nicht verlängern.
Häupl dazu: „Ich warte auf das Sicherheitskonzept. Experten werden uns dann sagen, wie lange sie brauchen dürfen.“
45 Minuten?
Glück im Unglück: niemand ist verletzt, der Hund im Tierschutzhaus und die Polizei wieder im gemütlichen Wachzimmer.
Wieder bewiesen: "Wien ist anders!"
-
2014-03-23 
Faymann & Spindelegger - die Ritter vom Feigenblatt! -
Nun haben die "feigen-ritter" das Feigenblattentdeckt:
Als Metapher bezeichnet das Feigenblatt einen Gegenstand, der vor einen anderen Gegenstand gestellt ist, um diesen in der Absicht zu verbergen, dessen moralisch angreifbare Eigenschaft nicht gewahr werden zu lassen.
„Jemandem oder etwas ein Feigenblatt umzuhängen“ hat umgangssprachlich die Bedeutung der unvollständigen oder notdürftigen Verdeckung eines obszönen oder unschicklichen Sachverhaltes.
Vorzugsweise ist der Ausdruck abwertend gemeint im Sinne eines Ablenkungsmanövers, das den wahren Sachverhalt scheinheilig verschleiern soll und hat hierbei eine Nähe zu dem Ausdruck „einen Deckmantel umhängen“. Quelle: wikipedia
Kein Ausschuss - eine Kommission!
Weil das Volk aufsteht - mehr als 79.000 haben die Petition unterzeichnet - rudert die Koalition zurück, lässt die Unterschriftenaktion weiter zu (auch wenn die Server zusammenbrechen weil der Andrang so gross zu sein scheint) und hängt sich das Feigenblatt U-Kommission um.
Ein wenig können wir offensichtlich doch bewegen!
Lasst uns weitermachen!
Um es Ihnen leichter zu machen, hier die entsprechenden links:
Petition 08 - Wir fordern einen Untersuchungsausschuss zum Thema Hypo Alpe-Adria
Petition 09 - Lückenlose Offenlegung der Hypo-Gläubiger
Petition 10 - umfassende Aufklärung des Hypo-Alpe-Adria-Finanzdebakels und
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses
Nicken Sie nicht - TUN Sie etwas!
-
2014-03-23 
Irmgard Griss - arm, fassungs- und zahnlos! -
Das Gebiss von Irmgard Griss ist - Gott sei Dank - intakt.
Die von ihr zu führende U-Kommission aber ist völlig zahnlos!
Bei einem U-Ausschuss
- stehen Zeugen unter Wahrheitspflicht
- können Zeugen zwangsweise vorgeführt werden
- können Unterlagen und Akten angefordert und eingesehen werden.
Die U-Kommission ist aber auf den good-will der Akteure aus Politik und Wirtschaft angewiesen!
No, die werden sich selber freiwillig belasten????
Klar, dass ÖVP und SPÖ gegen einen U-Ausschuss sind!
-
2014-03-22 
Schwarze Wirtschaftskompetenz? - Maria Fekter -
Maria Fekter hat 2010 eine "Bad Bank"-Lösung ausgeschlossen und sich damit das Verbot der EU - Geschäfte außerhalb der EU zu tätigen - eingehandelt.
Viele Geschäfte auf dem Balkan konnten somit nicht weitergeführt werden, so auch das positive Geschäft in Serbien.
Die Verhandlungsführung der "eisernen Mary" mit der EU wird von Experten und Insidern als "Missmanagement erster Güte" bezeichnet.
Klar, dass auch die ÖVP gegen einen U-Ausschuss ist!
-
2014-03-21 
Schwarze Wirtschaftskompetenz? - Josef Pröll -
Josef Pröll - ein Ritter von der traurigen Gestalt!
Er lädt am 13./14. Dezember 2009 die Bayern zu einer Krisensitzung nach Wien ein.
Er führt diese Gespräche OHNE Rechtsbeistand!!
Er verzichtet auf eine Klausel, dass sich Österreich an den Bayern schadlos halten kann, wenn Fakten falsch dargestellt wurden.
Er realisiert nicht, dass mehr als 40% der der faulen Geschäfte von den Bayern verursacht sind.
Trotzdem kauft er die Hypo - "a schene Leich" - um einen Euro zurück und "notverstaatlicht" die Hypo ohne ersichtliche Not!
Ein geniales Zeugnis von Wirstchaftskompetenz!
Klar, dass auch die ÖVP gegen einen U-Ausschuss ist!
-
2014-03-20 
Rote Wirtschaftskompetenz? - Ewald Nowotny -
Ewald Nowotny hat 1999 alle seine politischen Funktionen und Ämter zurückgelegt.
Damit konnte er aber seine politische Vergangenheit in der SPÖ nicht abstreifen.
Der Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich und Großen Silbernen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich hat seine Verdienste(?) und seine Wirtschaftskompetenz (er ist ja seit 2008-09-01 Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und erhielt ebenfalls 2008 das Ehrendoktorat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) bewiesen:
Ewald Nowotny hat 2010 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der Hypo und
der damaligen Finanzministerin Fekter eine "Bad Bank"-Lösung verhindert und
damit - laut Experten - einen Schaden von mindestens € 2.000,000.000 mitverursacht.
Jetzt ist er dafür! Späte und teure Einsicht.
Klar, dass auch die SPÖ gegen einen U-Ausschuss ist!
-
2014-03-19 
Herr Gahr (ÖVP) - ein wahrer Demokrat! -
Hört man auf den Vize-Obmann des Petitionsausschusses, Hermann Gahr (ÖVP), dann bedeutet Demokratie:
"Sollen sie halt noch eine (Petition) einbringen."
Es ist wahrhaft demokratisch mehr als 51.000 Österreichern den schlimmen Finger zu zeigen, indem man weitere Unterschriften zur Petiton für einen Untersuchungsausschuss zur Hypo Alpe Adria unmöglich macht - man schiebt die Petition an den Finanzausschuss ab und c'est fini!
"Sollen sie halt noch eine einbringen."
Danke Herr Gahr!
Vielleicht ist dann auch das Prüfverfahren der Volksanwaltschaft wegen Beschwerden über technische Hürden beim Unterschriften-Eintragen abgeschlossen und die Hürden beseitigt!
Es müssen viele Leichen in den roten und schwarzen Kellern liegen,
warum sonst fürchten SPÖ und ÖVP einen Untersuchungsausschuss wie der Teufel das Weihwasser?
-
2014-03-18 
Management-Nachhilfe für Spindelegger -
Jeder Managementschüler lernt, seine Verhandlungshebel nicht ohne Not preiszugeben.
Der Finanzminister von eigenen Gnaden, Herr Spindelegger, hat offenbar den Management-Grundkurs NICHT besucht, bevor er das sehnlich gewünschte - weil machtvolle - Amt antrat.
Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.
Das kann hier nicht zutreffen, da der Finanzminister nicht von Gott das Amt erhielt, sondern von ebenso mässig begabten Partnern der Regierung - die den Management-Grundkurs ebenso wenig besucht haben.
Wie kann man der Gegenseite signalisieren „Ihr braucht euch keine Sorgen wegen eurer Investments zu machen, es wird euch nichts passieren.
Ihr kriegt eure Anleihen zum vollen Preis ohne Abschläge aber mit Zinsen bezahlt"?
Jeder Jungmanager würde den Investoren die klare Message geben:
entweder ihr stimmt einem 40-50 prozentigen Haircut zu oder
wir gehen in eine Insolvenz und ihr riskiert, alles zu verlieren.
Von den USA über Zypern bis zu Lettland ist das vorexerzieret worden,
warum schaffen das österreichische Politiker nicht,
obwohl sie nicht die NMS besuchen mussten?
-
2014-03-17 
Heinisch Hosek zum Rapport! -
Kaum ein Lehrer hätte je gedacht hätten, dass sie sich einmal Gehrer zurückwünschen - doch es werden immer mehr.
Gehrer war eine Lichtgestalt im Vergleich zu Schmied und Heinisch-Hosek.
Gehrer hat immer gewusst, wovon sie spricht.
Ihre Nachfolgerinnen werden das niemals wissen.
HH (gesprochen: haha) zeigt was sie alles 'drauf hat:
- um PISA zu entgehen muss jetzt ein angebliches Datenleck (das seit Dezember(!) bekannt ist) herhalten
- um einer Evaluierung der NMS zu zu entgehen werden ALLE zentralen Schultests gestoppt
- sie wird die Landesschulräte "drängen" den Wechsel innerhalb des Schulsystems besser zu kontrolliern?!
Ja, ja - auch so kann man sich eine eigene Realität malen! -
2014-03-16 
Haltet die Diebe! - Spindelegger, Faymann & Co ... -
Sie stehlen unser Steuergeld für unfähige Manager und risikofreuudige Investoren
Meine Einstellungen lassen sich am ehesten mit "liberalem Wertkonservatismus" beschreiben und sind vom blauen Gedankengut meilenweit entfernt - aber das jetzt so aktuelle FPÖ-bashing in der causa HYPO ist reine "Haltet den Dieb!"-Taktik der mitschuldigen Diebe SPÖ und ÖVP!
Ja, es war der blaue - sich weit überschätzende - Landeshauptmann Haider, der die HYPO zur Finanzierung seiner Allüren und Grossmannssucht aufblähte - aber es waren auch Landtagsbgeordnete der ÖVP und SPÖ - i.B. auch der jetzige Landeshaupmann Kaiser (SPÖ) - die den wahnwitzigen Landeshaftungen zustimmten.
Es war aber auch Haider, der die HYPO der Bayrische Landesbank "andrehte" und daraus Kapital schlug (€ 500 Mio für den Zukunftsfond).
Dass die Bayrische Landesbank - als Mehrheitseigentümer der Hypo - die Bilanzsumme durch Vergabe - offensichtlich unzureichend besicherter - Kredite auf den Spitzenwert von € 43.336 Mio getrieben hat, ist auf das Missmanagement der damals verantwortlichen Bayern-Manager zurückzuführen.
Dass aber ein - offensichtlich geistig umnachteter oder sonstwie beeinflusster - Finanzminister am 13./14. Dezember 2009 zu einer Krisensitzung nach Wien einlädt und die Hypo-Leiche zurückkauft, schlägt dem Fass den Boden aus!
Dass die (ÖVP)-Finanzministerin Fekter durch ihre Verschleppungstaktik den Schuldenberg um mehrere Milliarden aufgestockt hat, ist das Sahnehäubchen aud der Suppe, die uns unsere Regierungen (SPÖ-OVP-Koalitionen) eingebrockt haben!
Die Gläubiger der Hypo Alpe-Adria dürfen aufatmen und
wir Österreicherinnen und Österreicher dürfen zahlen — wieder und immer wieder!
-
2014-03-16 
ELGA, Bundesrechenzentrum ...Daten Daten Super GAU -
 -->
-->
Warnung vor dem Daten-Super-GAUDie gesamte Bundesverwaltung ist wegen veralteter Systeme angreifbar geworden.
Der "Biefie-Skandal", bei dem durch ein Datenleck in einem rumänischen Server Prüfungsdaten von österreichischen Schülern an die Öffentlichkeit gelangten, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was tatsächlich drohen könnte. Der Professor für Softwaretechnik und Interaktive Informatik von der TU Wien, Martin Grechenig, warnt: "Fast alle in Österreich in Verwendung stehenden Systeme sind angreifbar."
Wie steht es mit der Datensicherheit in einem Land, das angeblich nicht einmal die Prüfungsergebnisse der Schüler unter Kontrolle hat? Was passiert, wenn der Zugriff auf Gesundheitsdaten gelingt und sich Pharmakonzerne für bestimmte Diagnosegruppen interessieren? Oder Versicherungen für Patientengruppen, Arbeitgeber für Bewerber, Geheimdienste für den Gesundheitszustand politisch exponierter Personen, Firmen für den Gesundheitszustand ihrer Mitbewerber oder Erpresser schlicht für vermögende Personen?
Angreifbar
 Univ-Prof. Martin Grechenig ortet angreifbare Systeme - Foto: wilhelm theuretsbacherGrechenig sieht Gefahrenherde für die gesamte Bundesverwaltung. Der Grund: "Die meisten jetzt bestehenden Systeme sind durch und durch angreifbar und löchrig, weil sie in Zeiten entstanden sind, zu denen Sicherheit und Privatheit der Informationen wenig bis keine Rolle spielten."
Univ-Prof. Martin Grechenig ortet angreifbare Systeme - Foto: wilhelm theuretsbacherGrechenig sieht Gefahrenherde für die gesamte Bundesverwaltung. Der Grund: "Die meisten jetzt bestehenden Systeme sind durch und durch angreifbar und löchrig, weil sie in Zeiten entstanden sind, zu denen Sicherheit und Privatheit der Informationen wenig bis keine Rolle spielten."
Die von Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek geortete "nicht gewährleistete Datensicherheit" betreffe die gesamte Republik. Datenunsicherheit sei mit ein Grund, dass das sogenannte "eVoting" vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde – was die Österreicher an Wahltagen weiterhin zu den Wahlurnen zwingt – und sie beeinträchtige die Verwaltung insgesamt: "Ministerien und Ämter müssen heute entweder täglich improvisieren, am Rande der Legalität arbeiten oder sie geben einfach auf."
Die Hintergründe des "Biefie-Skandals" sind noch unklar, vermutlich stecken nur herkömmliche Kriminelle dahinter – aber Grechenig sieht zusätzlich ein noch weit größeres Problem: den flächendeckenden Einsatz billiger US-amerikanischer Hard-und Software. Stichwort NSA-Skandal: Grechenig mutmaßt, dass US-Hersteller bei ihren Sicherheitssystemen "Hintertüren" für ihre Geheimdienste offen ließen. Das glaubt auch der frühere Verfassungsschutzchef und nunmehrige Unternehmensberater Gert-René Polli: Diese "Hintertüren" würden US-Diensten den Zugriff vor allem auf heimische Firmen und Universitäten öffnen. Dafür bräuchten sie aber auch Bundes-Daten.
US-Technik beherrsche laut Grechenig die sensibelsten Bereiche der Republik – etwa das Bundesrechenzentrum. Und im Hauptverband der Sozialversicherer habe eine NSA-nahe Firma Sicherheitssysteme bei der elektronischen Gesundheitsakte ELGA implementiert.
EU-Systeme
 Geheimdienstexperte Gert Polli kennt die Motive der Angreifer - Foto: Wilhelm TheuretsbacherDie dramatischen Befunde decken sich auch mit den Ergebnissen der EU-weiten Cyberkonferenz in Bonn im November, wo von EU-Kommissarin Neelie Kroes forderte, eigene IT-Systeme zu entwickeln. Denn solange die Europäer keine genügenden Serverkapazitäten schaffen und Systeme billig im Ausland kaufen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie ausspioniert werden.
Geheimdienstexperte Gert Polli kennt die Motive der Angreifer - Foto: Wilhelm TheuretsbacherDie dramatischen Befunde decken sich auch mit den Ergebnissen der EU-weiten Cyberkonferenz in Bonn im November, wo von EU-Kommissarin Neelie Kroes forderte, eigene IT-Systeme zu entwickeln. Denn solange die Europäer keine genügenden Serverkapazitäten schaffen und Systeme billig im Ausland kaufen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie ausspioniert werden.
Eine Erkenntnis, die auch der Vorstand des Bundesrechenzentrums teilt. In einer Auskunft an den KURIER wird zwar eingeschränkt, dass man neben US-Unternehmen wie IBM, Microsoft und anderen auch große europäische Hersteller wie SAP und lokale Dienstleister beschäftige. Aber: "Es ist anzumerken, dass aus strategischer Sicht mehrere und stärkere europäische IT- Unternehmen wünschenswert wären."
Beim Projekt ELGA droht der tatsächliche Daten-Super-GAU
Der Lösungsvorschlag von Univ-Prof. Martin Grechenig, maßgeblicher Architekt des eCard-Systems, klingt einfach: "Wenn sie alle Teile eines Systems IT-technisch selbst gebaut, programmiert, geprüft haben, dann kann dort niemand einbrechen." Grechenig verweist auf die Rufdatenspeicherung. Die wird über das Bundesrechenzentrum (BRZ) abgewickelt. Doch ein Missbrauch durch einen BRZ-Mitarbeiter sei auszuschließen. Denn die Daten wurden so verschlüsselt, dass sie nur der Endabnehmer – in der Regel ein Staatsanwalt – lesen könne. Das System hat er auch im Parlament für die elektronische Gesundheitsakte ELGA vorgeschlagen, ist aber damit abgeblitzt. Während die ELGA-Verantwortlichen die Sicherheit beteuern, fürchtet Grechenig hier einen echten "Daten-Super-GAU".
Unterstützung bekommt er von Hans Zeger von der Arge Daten: "Ein System in dem es keinen Letztverantwortlichen gibt, kann nicht sicher betrieben werden." ELGA sei verfassungswidrig.
-
2014-03-13 
Solar Eigenbedarf -
 -->
-->
Abgabe auf Solar-Strom auch für den Eigenbedarf Da sich immer mehr Haushalte Solaranlagen zulegen, gehen dem Finanzminister Einnahmen verloren.
Der Fotovoltaik-Verband ist in Aufregung. Nach einem Erlass des Finanzministeriums muss für Strom, der selbst erzeugt und verbraucht wird, eine Abgabe entrichtet werden. Ab einer Freigrenze von 5000 Kilowattstunden sind 1,5 Cent pro Kilowattstunde für den gesamten selbst erzeugten Strom zu bezahlen. Dadurch sinke die Marktfähigkeit von Solarstrom, ärgert sich Hans Kronberger, Präsident von Photovoltaic Austria. Der Verwaltungsaufwand sei enorm. Es wurde eine Unterschriftenaktion gegen den Erlass gestartet (zur Petition).
Haushalte, die Strom aus dem Netz beziehen, zahlen derzeit Steuern in Höhe von insgesamt 31 Prozent. Bei der Stromerzeugung für den Eigenbedarf sind bisher keine Steuern angefallen. Da sich immer mehr Haushalte Solaranlagen zulegen, gehen dem Finanzminister Einnahmen verloren. Das soll durch den Erlass korrigiert werden. Haushalte, die selbst Strom erzeugen und weniger aus dem Netz beziehen, zahlen einen geringeren Netztarif.
-
2014-03-13 
Ökostrom xxx -
 -->
-->
Energiewende: Ökostrom mit Kurzschluss Die Haushalte zahlen die Rechnung, während Großabnehmer und Investoren profitieren. Fragen und Antworten.
Die Energiewende treibt seltsame Blüten: zum Beispiel neue Gaskraftwerke, die nicht in Betrieb genommen werden. Oder sinkende Großhandelspreise, die bei den privaten Haushalten aber nicht ankommen. Die Markteingriffe zur Förderung der Erneuerbaren Energie haben ein paar unerwünschte Nebenwirkungen.
Warum wird Erneuerbare Energie wie Fotovoltaik oder Windenergie gefördert?
Wegen des Klimawandels hat es sich die EU zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß zu verringern. Außerdem sollen durch den Ausbau von Erneuerbarer Energie die Nachhaltigkeit gefördert und Energieimporte gesenkt werden. Die Gasimporte zu verringern ist aber schwierig. Es gibt noch keine preiswerte Technologie für eine alternative Erzeugung.
Wie lange wird gefördert?
Derzeit gibt es meist eine einmalige Investitionsförderung oder 13 Jahre lang garantierte Einspeisetarife. Danach müssen sich die Anlagen am Markt bewähren. Bei Anlagen für die Deckung des privaten Verbrauchs kann es zwanzig Jahren dauern, bis sich die Investition rechnet.
Wer trägt die Kosten?
Die Kosten für die Förderung der Erneuerbaren Energie werden auf die Verbraucher überwälzt. Heuer zahlt ein Durchschnittshaushalt etwa 80 Euro Ökostromzuschlag. 2015 werden es 100 sein. In Deutschland beträgt der Ökostromzuschlag sogar 250 Euro. Anders als in Österreich gibt es beim Nachbarn Ausnahmen für die Industrie und keine Deckelung der Förderung.
Wer profitiert von der Energiewende?
Da der Ökostrom gefördert wird, kann er billig verkauft werden. Wegen der großen Mengen an Ökostrom, die v. a. in Deutschland anfallen, ist der Großhandelspreis auch in Österreich gesunken. Davon profitiert vor allem die Industrie. An die Haushalte sind die Preisvorteile bisher nur im geringen Maße weitergegeben worden. Weiters profitieren jene, die in großem Stil in Erneuerbare Energie investiert haben. Da der erzeugte Strom zu einem Fixpreis verkauft werden kann, tragen sie kein Risiko. Wegen der höheren Nachfrage nach Holz und Holzspäne als Brennstoff ist der Holzpreis gestiegen.
Warum geht es den Energielieferanten schlecht?
Durch den niedrigen Großhandelspreis kommen alle unter Druck, die Energie erzeugen und verkaufen. Die Gewinnspanne ist kleiner geworden. Stromerzeugung aus Gaskraftwerken ist derzeit unrentabel.
Warum steigt in Deutschland der CO2-Ausstoß?
Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, kommt wenig Energie aus Solar- und Windkraftwerken, sondern billiger Strom aus Kohlekraftwerken mit hohem CO2-Ausstoß.
Kommt es zur Rückkehr der Atomenergie?
Die Atomenergie war nie weg. Länder wie Frankreich oder Großbritannien haben keinen Ausstieg aus der Kernenergie verkündigt. Großbritannien möchte für neue Atomkraftwerke eine Förderung für die nächsten 35 Jahre, weil sie keine CO2-Emissionen verursachen. China plant den Bau Dutzender neuer Atomkraftwerke. Japan will wieder in die Kernkraft einsteigen. Für den Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie gab es auch politische Gründe. Nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima befürchtete die Deutsche Bundesregierung massive Verluste bei der Bundestagswahl.
-
2014-03-13 
Heinisch-Hosek und die PISA-Verschwörung -
PISA ist peinlich!
PISA zeigt das Unvermögen der Ministerin und auch ihrer Vorgänger auf.
PISA zeigt auch die mangelhafte Qualifikation vieler Lehrer auf.
Somit sind Ministerin und Lehrergewerkschaft höchst interessiert, dieses Evaluierungsinstrument zu Fall zu bringen.
Und nun zur Verschwörungstheorie:
Dezember 2013: das Bifie und das Unterrichtsministerium wird informiert, dass ungesicherte Daten der IKM im Netz aufgetaucht sind. Was geschieht? NICHTS!
Schon 2 Monate später - wirklich rasch ;-) - reagiert Frau Ministerin:
2014-02-25: Heinisch-Hosek wünscht sich, dass die Behörden die möglichen Tatbestände "sofort und lückenlos" aufklären. Nach Abschluss der Ermittlungen und "erst, wenn Schuldige gefunden sind", könne man auch beurteilen, welche Schlüsse zu ziehen seien.
2014-03-13 Die Ermittlungen sind NICHT abgeschlossen!
Die Schuldigen sind NICHT gefunden!
aber die Schlüsse werden dennoch gezogen:
Die Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek sagt "was kümmert mich der Blödsinn, den ich am 25.02. gesagt habe" und sagt alle bundesweit durchgeführten Bildungstests ab!
... und damit entziehen sich Ministerin und Lehrer der
- möglicherweise objektiven - Beurteilung ihrer Leistungen!
Chapeau!
Das Bundesinstitut für Bildungsforschung - welch seltsames Konstrukt - weist darauf hin, dass daraus organisatorische und finanziellem Probleme in Millionenhöhe entstehen können/werden.
Das ist der Bildungsministerin - richtig - WURSCHT!
Dass man die Bildungsstandard-Tests, die ja auf Papier sind, von den Schülern machen lassen und sie später digitalisieren kann ist der Ministerin - richtig - ebenfalls WURSCHT!
Die neue Busenfreundin der Bildungsministerin - Frau Ministerin Karmasin - versteht die "Entscheidung zugunsten der Datensicherheit".
Hallo Frau Karmasin, hören Sie doch einmal auf Hans Zeger, Geschäftsführer der ARGE-Daten und oberster Datenschützer des Landes, der sagt: "Mit den Testdaten des Bundesinstitutes für Bildungsforschung fängt niemand wirklich etwas an. Und betreffend der Lehrer-Daten handelt es sich nur um die eMail-Adressen. Die sind bekannt."
Sorgen Sie sich lieber um die Datensicherheit bei ELGA!
ÜBERIGENS: Wie war das eigentlich vor PISA? Waren wir damals lauter Idioten?
NEIN, waren wir nicht.
Im Gegenteil, denn wir mußten noch Leistungen erbringen
von denen die heutigen kinder nicht zu träumen wagen,
Disziplin - wenn auch manchmal übertrieben - wurde auch verlangt.
Die Kuschelschule macht Idioten aus unseren Kindern. Da nützen die ganzen Test´s nichts!
- und Bildungspolitik gibt's leider schon lang nicht mehr!
-
2014-03-16 
Roland Düringer offener Brief an Spindelegger -
"Der beste Bankraub ist der, den keiner bemerkt"
... so titelt der Kurier vom 17.03.14 und weist auf einen offenen Brief Düringers an Spindelegger hin, den dieser am 09.03.14 geschrieben und am 11.03.14 veröffentlicht hat.
Düringer bittet in seinem Video auch alle verantwortungsbewussten Österreicher die Petitionen zur umfassenden Aufklärung des Hypo-Alpe-Adria-Finanzdebakels zu unterstützen - ein Wunsch, den auch ich dringend unterstütze!
Um es Ihnen leichter zu machen, hier die entsprechenden links:
Petition 08 - Wir fordern einen Untersuchungsausschuss zum Thema Hypo Alpe-Adria
Petition 09 - Lückenlose Offenlegung der Hypo-Gläubiger
Petition 10 - umfassende Aufklärung des Hypo-Alpe-Adria-Finanzdebakels und
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses
Nicken Sie nicht - TUN Sie etwas!Hier der Brief im Wortlaut -
R. Düringer möge mir verzeihen, wenn ich möglicherweise sein © verletze ;-)
An das Bundesministerium für Finanzen
z.H. Herrn Vizekanzler und Finanzminister
Dr. Michael Spindelegger
Johannesgasse 5
1010 Wien
Betreff: Unser Steuergeld
Werter Herr Dr. Spindelegger,
so wie vielen anderen Steuerzahlern liegt auch mir seit geraumer Zeit etwas im Magen, etwas wirklich schwer Verdauliches: Die Hypo Alpe Adria International AG. Hier scheint ja einiges ganz schön schief gelaufen zu sein, obwohl ich den Verdacht hege, dass es für so manchen ganz gut gelaufen ist und leider auch noch weiterhin gut laufen, vielleicht sogar zu einem glücklichen Ende kommen wird - glücklich deswegen, weil nicht zur Verantwortung gezogen. Der beste Bankraub ist ja immer noch der, den keiner bemerkt.
Für den Großteil der Bevölkerung allerdings ist es wie so oft wieder einmal schlecht gelaufen. Die Bürger müssen wohl wieder einmal bürgen, mit ihrer Arbeitsleistung und ihren kleinen Vermögen. Wir Steuerzahler werden für die Machenschaften der Gierigen bestraft und die Umverteilung von Fleißig zu Reich geht munter weiter. Es sei denn, es finden sich mutige Politiker, die endlich aufstehen, den Rücken gerade machen und das tun, wofür wir sie bezahlen: den Menschen im Lande zu dienen, Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung zu treffen und bereit zu sein, die richtigen Fragen zu stellen:
Warum, zum Beispiel, werden nicht alle für die Kreditvergabe und die ordentliche Geschäftsführung der Hypo Alpe Adria Verantwortlichen, die Vorstände und Aufsichtsräte, geklagt und zur Rechenschaft gezogen?
Warum wird einem heimischen Schuhfabrikanten von Seiten der Finanzmarktaufsicht der Prozess gemacht, bei diesen Machenschaften aber offenbar ein Auge zugedrückt?
Welche Banken, Finanzinvestoren und Hedgefonds kassierten als Gläubiger seit der Verstaatlichung unsere Steuergelder und werden noch weiter kassieren?
In welchem Ausmaß hat die Raiffeisen Gruppe davon profitiert?
Warum haftet die Bayrische Landesbank nicht für die Vollständigkeit und ordnungsgemäße Bewertung der Bilanzpositionen in der Übergabebilanz? Wurde diese Klausel im Übernahmevertrag im Tausch gegen schlechtes Geld gestrichen?
Warum lassen wir uns jetzt unter anderem von einem ehemaligen Investmentbanker namens Dirk Notheis um teures Geld beraten – jener Herr, der damals die Bayrische Landesbank im Rahmen der Verstaatlichung beraten und damit uns über den Tisch gezogen hat – einem "Experten" also, gegen den in Deutschland wegen Beihilfe zur Untreue in einem ähnlichen Fall ermittelt wird?
Und vor allem: Warum konnte ein damaliger Finanzminister eine "geschminkte Leiche" wie die Hypo auf unsere Kosten zurückkaufen? Von welchem Teufel wurde er damals geritten? Wer oder was hat ihn dazu getrieben? In wessem Interesse geschah diese Blitzaktion, hatte vielleicht Raiffeisen die Hände im Spiel? Immerhin gewähren sie dem „pflegebedürftigen und politikverdrossenen“ Josef Pröll seither ja Unterschlupf.
Herr Dr. Spindelegger!
Als höchster politischer Vertreter in abgabenrechtlichen Angelegenheiten sollte es Ihr Interesse sein, weil Interesse aller Staatsbürger, diese Causa aufzuklären, die Schuldigen, Mittäter und Profiteure zu finden, bereits geflossene Steuerzahlungen bis zur Zieladresse zu verfolgen und weitere Zahlungslasten der Bevölkerung in dieser schändlichen Angelegenheit zu verhindern.
Wenden Sie weiteren Schaden ab und lehnen Sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht länger ab. Dienen Sie nicht weiter den Finanzhaien, ihren Verbündeten und den schwarzen Schafen ihrer Zunft, sondern uns, denen Sie verpflichtet sind.
Lassen Sie es nicht zu, dass unser Glaube an den Rechtsstaat und die Demokratie endgültig erlischt.
Für viele Menschen in diesem Land wird es, nach und nach, enger und enger und sie haben die Schnauze gestrichen voll. Verhindern wir, dass ihre Wut eines Tages auch unsere Strassen heimsucht und der Staat sein wahres Gesicht zeigen muss: Die Diktatur.
Ich selbst habe mich einer parteiunabhängigen Bürgerinitiative angeschlossen, in der wir die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Causa Hypo fordern. Denn wer ein Problem erkennt und nichts dagegen tut, ist selbst ein Teil des Problems.
Ich hoffe auf eine weise Entscheidung ihrerseits, dadurch bliebe uns das Kasperltheater eines "Weisenrates" erspart.
Mit freundlichen Grüßen,
Roland Düringer
PS: Und falls ihnen bei Gelegenheit Herr Faymann über den Weg läuft, sprechen sie ihn bitte darauf an und versuchen sie auch ihn auf die Seite des Volkes zu ziehen.
-
2014-03-09 
Der Vollkasko-Staat Österreich -

Österreich ist ein "Vollkaskostaat" (© Peter McDonald), der sich mit Höchstprämien bezahlen läßt, denn Österreichs Steuer- und Abgabenquote liegt weltweit im obersten Bereich!
Die Sozialsiten - pardon "die Sozialdemokratie" (also einen Demokratie in der Demokratie) - und die Gewerkschaften haben die Anspruchshaltungen an den Staat politisch gezielt gefördert und die Anreize für Eigenverantwortung ebenso gezielt reduziert.
Die roten, grünen und sonstigen Verfechter/Verfechter/Durchsetzer des "mainstream" haben damit eien Ausgabenblock geschaffen, der das Budget dramatisch belastet.
Wir Versicherungsnehmer = Prämien- vulgo Steuerzahler haben meist keine Ahnung wie und wofür unsere Beiträge verwendet werden.
Sollten sie - wider Erwarten - informiert sein, können sie nicht entscheiden ob sie für die Förderung der Pflege der "Anatolischen Langhalslaute" oder für die Prävention vor beeinflussbaren Zivilisationskrankheiten (80% t der aktuellen Krankheiten) einsetzen wollen. Dafür haben wir ja unsere Politprofis, die ihre Wirtschaftskompetenz in der aktuellen causa Hypo deutlich erkennen lassen. -
2014-03-09 
Sozialpolitik work -
Sozialpolitik ist kein Monopol der Linken
Vier Leitplanken für eine moderne, bürgerliche Sozialpolitik.
Peter McDonald GastkommentatorDie ÖVP hat die Sozialpolitik viel zu lange der Sozialdemokratie und deren Gewerkschaftern überlassen. Österreich wurde zum "Vollkaskostaat" und damit entstand ein kaum beherrschbarer Ausgabenblock im Staatsbudget. Gleichzeitig sind wir bei einer Steuer- und Abgabenquote gelandet, die sowohl Wirtschaftswachstum als auch zusätzliche Beschäftigung bremst.
Der bisherige Weg war, Anspruchshaltungen an den Staat politisch gezielt zu fördern und möglichst wenige Anreize für Eigenverantwortung und Prävention zu geben.
Wohlfahrt
Bürgerliche Sozialpolitik differenziert zwischen Wohlfahrt und Wohlstand. Während Wohlfahrt Ausdruck der Würde aller Menschen und zentrale Aufgabe der Sozialpolitik ist, kann Wohlstand nur das Ergebnis wirtschaftlicher Leistung sein. Vier Leitplanken geben die Richtung vor:
1. Bürgerliche Sozialpolitik trägt zur Vermeidung jener Umstände bei, die sozialstaatliche Intervention erforderlich machen. Heute liegen 80 Prozent der Krankheitslast auf beeinflussbaren Zivilisationskrankheiten. Trotzdem fließen nur zwei Prozent der Gesundheitsausgaben in die Prävention. Am Arbeitsmarkt wird überproportional in die Alimentierung investiert, statt bei der Ursache anzupacken – der verschlafenen Weiterentwicklung des Bildungssystems.
2. Sozialpolitik darf nicht auf staatliche Fürsorge reduziert werden und Abhängigkeiten schaffen. Das Bewusstsein für eigene Verantwortung muss gestärkt werden. Damit mehr Verantwortung übernommen wird, sollen dafür Anreize geschaffen werden. Hilfe zur Selbsthilfe muss das Ziel sein.
3. Gleichheit, getarnt als soziale Gerechtigkeit, wo jeder den gleichen materiellen Wohlstand haben soll, hat nichts mit Sozialpolitik zu tun, sondern ist die Umschreibung des Kommunismus. Anliegen bürgerlicher Sozialpolitik ist es nicht, materielle Ergebnisgleichheit durch staatliche Maßnahmen zu erzwingen, sondern vielmehr Chancengerechtigkeit für alle zu ermöglichen.
4. Soziale Leistung für den einen setzt zumeist die Finanzierung durch einen anderen voraus. Deshalb muss bürgerliche Sozialpolitik individuelle Lebensrisiken berücksichtigen und deren sozialstaatliche Absicherung auch mit zumutbaren Eigenleistungen verbinden. Der Sozialstaat soll keine Strukturen und Verhältnisse andauernder Alimentierung und daraus resultierender Abhängigkeit schaffen.
Reduktion der Steuerlast
Österreichs Steuer- und Abgabenquote liegt weltweit im obersten Bereich. Wir brauchen dringend eine Reduktion dieser Steuer- und Abgabenlast und dafür die Bereitschaft, das Sozialsystem laufend weiterzuentwickeln. Nur so kann das Solidarsystem und damit die soziale Sicherheit in das nächste Jahrzehnt mitgenommen werden.
Österreich braucht eine neue Sozialpolitik – moderner, nachhaltiger, bürgerlicher.
Mag. Peter McDonald ist Direktor des Österreichischen Wirtschaftsbundes, geschäftsführender Obmann der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft und stv. Vorsitzender der Konferenz der aller Österreichischen Sozialversicherungsträger.
-
2014-03-08 
Weltfrauentag: Pfeift auf Quote - kämpft für Kohle! -
Die frischgebackene Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) fordert eine "Flexi-Quote" deren Nichterfüllung mit "sanften Sanktionen" geahndet werden (Die Geldbußen soll nicht an den Staat, sondern in "Maßnahmen zur Frauen- und Familienförderung" fließen).
Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Anna-Maria Hochhauser is not amused: "Es ist nicht die Zeit, Zwangsmaßnahmen zu fordern, auch nicht am 103. Frauentag. Eine verpflichtende Quote für die Privatwirtschaft ist nicht denkbar. Ich kann doch der privaten Wirtschaft nicht vorschreiben, wie sie Personal zu besetzen hat."
Auch der Generalsekretär der Industriellen-Vereinigung, Christoph Neumayer meint: ",Zwangsbeglückung‘ über Quoten ist der falsche Weg." Heimische Unternehmer seien "gewohnt, sich selbst Ziele zu setzen. Da braucht es nicht immer Verordnungen der Regierung, egal ob sie Pflicht- oder Flexi-Quote heißen."
No Frau Minister, da haben Sie sich im eigenen Nest aber nicht sehr beliebt gemacht ;-)
Die ebenfalls frischgebackene Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), erleidet einen Rückfall ins Frauenministerium, möchte "echte Quoten" für die Privatwirtschaft und freut sich, "... dass eine ÖVP-Ministerin das Wort Quote in den Mund nimmt".
Anders sieht das ÖGB-Vizechefin Sabine Oberhauser, die meint: "Gehen wir weg vom Begriff Quote, nennen wir es Kennzahl." - Was für eine hochintelligente Differenzierung :-)))
Die bisherigen politischen Quotenfrauen Maria Fekter, Beatrix Karl, Claudia Bandion-Ortner, Christine Marek, Doris Bures und Claudia Schmied sind bereits Geschichte und haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Die frühere Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek war mit ihrer Forderung: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ja auch hinreichend erfolglos.
Die selbsternannten "Frauenvertreterinnen" - keine Frau hat sie je explizit gewählt - sollten sich mehr um die Durchsetzung der äußerst legitimen Forderung
"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" kümmern!
Pfeift auf die Quote! Fordert sie dazu auf und kämpft auch selber dafür!
-
2014-02-28 
Die gemeingefährliche Behinderung der Bildungspolitik -

Der oberste AHS-Lehrervertreter Eckehard Quin (FCG) sieht keinen Sinn in der Matura, auch Frau Rudas sekundierte:"Derjenige Schüler hat immerhin schon 8 Jahre geschafft."
Grüne wollen Noten in Volksschule abschaffen
Sitzenbleiben in der Oberstufe wurde 2012 von der Regierung abgeschafft
Das Projekt "Neue Mittelschule" läuft offensichtlich "suboptimal" und wird vom RH zerpflückt
Ein neues Lehrerdienstrecht muss her, ohne zu wissen wie das Schul- und Bildungssystem in Zukunft aussehen soll
Zwischen Bund und Ländern gibt es ein Kompetenzgerangel, vermutlich weil Vorarlberger Schüler sich dramatisch von den Burgenländern unterscheiden ....
Unser Bildungssystem wird seit Jahrzehnten systematisch ruiniert, die Nivellierung (nivellieren = einebnen, gleichmachen ...) nach unten scheint Ideologie zu sein.
Wohlfühlpädagogen, grüne Kuschelbären und die "um die Kinder-Kümmerer" bevorzugen es, dass besser alle gleich schlecht sind, statt unterschiedlich - "fachspezifisch" und oder talentiert - gut sind. Österreichs Konkurrenzfähigkeit im internationalen Konzert ist auf die Kreativität, den Erfindergeist, den Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit der Bürger angewiesen. Zu nivellieren, "es den Kindern leichter machen", Leistungsstreß zu vermeiden und was sich manche Leute noch an Behütungsmethoden ausgedacht haben, wird die Lebensfähigkeit underer Kinder in realen Welt der Wirtschaft nicht wirklich stärken. -
2014-02-26 
Wasser predigen und Wein trinken! = Rudas & Stanford -
Laura Rudas kan es nicht lassen (un)feiwillig Kabarettnummern zu liefern.
Auch sie setzt sich für die mittlerweile gemeingefährliche Behinderung der Bildungspolitik in Österreich ein.
Auch sie stellt die Sinnhaftigkeit der Matura in Frage, obwohl inden meisten EU-Ländern eine Reifeprüfung, Matura, Abitur u.ä. für den Zugang zu höherer Bildung nach wie vor notwendig ist.
Auch sie kann sich eine andere Form der Benotung oder deren Abschaffung vorstellen, obwohl fast ein Drittel der 15- bis 16-Jährigen in Mathematik, Lesen und Naturwisenschaften nicht einmal Mindeststandards erreichen.
Auch sie tritt für eine Abschaffung der Studiengebühren ein.
Und jetzt tritt sie ein Studium an der amerikanischen Elite Universität in Stanford an -
einen einjährigen Master in "Management for Experienced Leaders" -
(is she really an "Experienced Leader"???), wo sie
benotet werden wird,
eine Abschlussprüfung machen muss und
zumindest $ 116.500 an Studiengebühren zahlen muss!
Life is a cabaret! Rudas is also in this case a famous actress!
-
2014-02-26 
Schwerer Schlag für die Kabarett-Szene: Rudas geht! -

-
2014-02-25 
Weise Böcke werden zu Spindi's Gärtnern! -
Spindis Weise haben ihre Kompetenz hinreichend bewiesen
Morgan Stanley hat 2009 die Bayern LB beraten, die die Notverstaatlichung der Hypo durch Österreich erzwungen hat - der Deutschland-Chef war Dirk Notheis, Dirk Notheis rettete den ÖGB vor der Pleite, er half, die angeschlagene Gewerkschaftsbank Bawag an Cerberus - einen US-Fonds - zu verkaufen.
Der Deutschland-Chef der US-Bank Morgan Stanley, der dem Land Baden-Württemberg bei dem Rückkauf des Energieriesen EnBW half – und dabei so intransparent und seltsam agierte, dass die Landesregierung stürzte, er selbst seinen Geschäftsführerposten verlor und seither die Staatsanwaltschaft am Hals hat.
Mit Dirk Notheis (45), den der frühere Chef der WestLB, Ludwig Poullain, in einem Zeitungsinterview
„dreist, ungehobelt, schamlos in Diktion und Wortgebrauch“ genannt hat,
hat sich Michael Spindelegger wahrlich einen illustren Berater ins Hypo-Boot geholt. aber das stört den Finanzminister nicht, wahrscheinlich hat er ihm die Beichte abgenommen und Notheis hat bereut.
Die Managementberatung Oliver Wyman, die bereits im Dezmber 2013 die Hypo - für einen schlappen 7-stelligen Betrag - beraten hat(die Insovenz wurde als "günstigste" Lösung dargestellt, allerdings wurde diese Lösung NICHT nachgerechnet - vermutlich war das bei dem schmalen Honorar nicht mehr drin), darf wieder an den Futtertrog, der die Hypo-Kosten weiter aufblähen wird.
Danke Herr Finanzminister, so beweisen Sie einmal mehr Kompetenz und werden damit sicher Ihre Vertrauenswerte erheblich steigern! - ODER?
-
2014-02-25 
Spindis song: AAA is' bald nimmer da! -
Vertrauen und Verlässlichkeit ist das A und O im Wirtschaftsleben!
Klaus Liebscher bezeichnet den Umgang der Regierung, i. B. des Finanzministers mit der causa Hypo als "Verantwortungslos", Liebscher, der auch Aufsichtsratschef der Bank ist, platzt jetzt der Kragen. Zum KURIER sagt Liebscher auf die Frage, was ihn mittlerweile an der Hypo-Causa am meisten nerve:
"Weniger Fragen als die Tatsache, mit welcher Sorglosigkeit, aber auch Verantwortungslosigkeit in der Öffentlichkeit wie auch in der Politik mit dem weiteren Schicksal der Bank umgegangen wird."
Trotz der "klaren Entscheidung der Regierungsspitze, eine Anstaltslösung (Bad Bank) vorzubereiten und in der Folge umzusetzen", werde weiterhin die mögliche Insolvenz der Bank in den Raum gestellt.
Und, weiter: "Dies löste bereits negative Reaktionen von Ratingagenturen wie auch beachtliche Unsicherheiten bei internationalen Investoren und deren Vertrauen in den heimischen Finanzplatz und dessen wesentliche Institutionen aus." Die Kernbotschaft, des früheren Nationalbank-Chefs: "Dies ist meines Erachtens eine unverantwortliche Doppelstrategie! Es geht schließlich um eine dem Staat gehörende Bank."
Das "Herumeiern" von Kanzler ("Ich schließe den Konkurs nicht mehr aus.") und Finanzminister (eine Hypo-Pleite ist weiter als Option zu bezeichnen) zertört das kaum noch vorhandene Vertrauen, nicht nur der Bürger, sondern ruft nun auch die Rating-Agenturen auf den Plan und Bankenaufseher in Kroatien und Bosnien-Herzegowina lassen durchblicken, dass sie im Falle einer Pleite der Bank ihre jeweiligen Landes-Hypos sofort verstaatlichen würden.
Moody’s hat schon im Oktober vor dem Verlust des Triple-A gewarnt, sollte Österreich erneut gezwungen sein, notleidenden Banken unter die Arme zu greifen.
Nicht der drastische Schuldenanstieg durch die Hypo-Abwicklung ist das Kernproblem, sondern die Insolvenzdebatte, respektive die Verunsicherung der Anleihe-Zeichner über den Wert der Haftungen für ihr Investment.
Auch die Bonitätswächter von Fitch setzten Österreich wegen des Bankenskandals auf die Watchlist - der Ausblick könnte auf "negativ" gedreht werden, hieß es am 2014-02-21.
Doch dazu kam es doch NOCH nicht: Die Ratingagentur belässt Österreich das Spitzenrating AAA, der Ausblick bleibt stabil.
-
2014-02-24 
Spindelanecker verliert einen wichtigen Mitstreiter! -

Sektionschef Gerhard Steger wirft Job hin
Spindelegger verliert wichtigsten Beamten an Rechnungshof.
Finanzminister Michael Spindelegger laufen die Top-Leute davon. Nach dem bitteren Rücktritt von Hypo-Taskforce-Chef Klaus Liebscher am vergangenen Freitag platzte am Dienstag die nächste Bombe: Mit einem dürren Satz in einem eMail, er sei nur noch bis Donnerstag im Amt, warf der mächtige Chef der Budgetsektion im Finanzministerium, Gerhard Steger (56), das Handtuch. Nach 33 Jahren im Ministerium und 16,5 Jahren als Chef der Budgetsektion – das Schwert jedes Finanzministers beim Sparen – kehrt Steger mitten in der Budgeterstellung dem Finanzministerium den Rücken. Am Rande des Parlamentsplenums war Stegers Abgang Tagesgespräch. Folgende Gründe für den überraschenden Schritt wurden kolportiert: Steger sei insgesamt "sauer" auf die Politik, weil nicht in erforderlichem Ausmaß gespart werde. Steger soll intern seit Herbst 2013 darauf drängen, dass Österreich die EU-Empfehlung erfülle, bereits im Jahr 2015 ein strukturelles Nulldefizit zu erwirtschaften. "Das hätte ein Umkrempeln des Budgetpfads erfordert, es hätten, auf die Legislaturperiode gerechnet, um acht Milliarden Euro mehr eingespart werden müssen", sagt ein Budgetexperte. Den schärferen Sparkurs wollten weder SPÖ noch ÖVP mittragen – sie halten am strukturellen Nulldefizit erst 2016 fest. Steger gehört der SPÖ an, hat aber zuletzt auch in seiner Partei – wegen des errechneten Budgetlochs von 40 Milliarden – an Rückhalt verloren. In der SPÖ wirft man ihm vor, er würde als Beamter "Politik machen". Weiters werden Unstimmigkeiten mit Finanzminister Michael Spindelegger kolportiert. Steger soll über die von Minister zu Minister schlechter werdende Qualifikation im Ministerkabinett frustriert gewesen sein. Jedenfalls soll Steger zum Schluss zwischen allen Sesseln gesessen sein. budgethearing, steger, fekter, schieder… Das Schwert beim Sparen: Als Sektionschef erlebte Gerhard Steger (li.) ab 1997 sechs Finanzminister - Foto: KURIER /gruber franz Steger selbst stellt auf KURIER-Nachfrage alle Umstimmigkeiten in Abrede: "Die Zusammenarbeit mit Spindelegger war sehr gut. Der Streit um das Budgetloch hat überhaupt nichts mit meinem Abgang zu tun. Wenn ich mich von solchen Dingen beeindrucken lassen würde, wäre ich falsch am Platz. Ich habe eine Haut wie ein Elefant." Er habe "einfach riesige Lust auf Neues" und mit der erfolgreichen Umsetzung der Haushaltsrechtsreform seine "Mission erledigt", sagt Steger. Beworben hat er sich für die Nachfolge von Oscar Herics, der als österreichischer Vertreter in den EU-Rechnungshof nach Luxemburg wechselt. Und die Bewerbung gewonnen: Er wird im Rechnungshof künftig der Chefkontrollor für den Finanzbereich und die Banken. Damit ist Rechnungshofpräsident Josef Moser ein Coup gelungen. "Wenn jemand weiß, wo es in dieser Republik Ineffizienzen gibt, ist das Steger", sagt ein Abgeordneter. "Da können sich jetzt alle warm anziehen." Der Rechnungshof ist ein Kontroll-Instrument des Parlaments – und Steger wurde gestern bereits als potenzieller Nachfolger von Moser gehandelt. Mosers Amtszeit läuft Mitte 2016 aus, er kann nicht wieder bestellt werden. (KURIER) Erstellt am 25.02.2014, 13:41
-
2014-02-23 
Weiser Weisen Rat: Spindi go home!! - Dem Ex-Investmentbanker und neuen Regierungsberater und in Sachen Hypo Alpe Adria eilt ein zweifelhafter Ruf voraus. 24.02.2014 | 18:23 | (Die Presse) Wien. Ein ordoliberaler CDUler, der den Österreichischen Gewerkschaftsbund vor der Pleite rettet, indem er ihm hilft, die angeschlagene Gewerkschaftsbank Bawag an einen US-Fonds zu verkaufen. Ein Deutschland-Chef der US-Bank Morgan Stanley, der dem Land Baden-Württemberg bei dem Rückkauf des Energieriesen EnBW hilft – und dabei so intransparent und seltsam agiert, dass die Landesregierung stürzt, er selbst seinen Geschäftsführerposten verliert und seither die Staatsanwaltschaft am Hals hat: Mit Dirk Notheis (45), den der frühere Chef der WestLB, Ludwig Poullain, in einem Zeitungsinterview „dreist, ungehobelt, schamlos in Diktion und Wortgebrauch“ genannt hat, hat sich Michael Spindelegger wahrlich einen illustren Berater ins Hypo-Boot geholt.
-
2014-02-23 
Schröcksnadel - Problem lösen? NEIN! rausschmeißen! -
Probleme lösen bedeutet Hirn anstrengen und arbeiten!
Danke Herr Schröcksnadel für einen weiteren Beweis für Ihre hinterfragenswerte Kompetenz.
Wenn man ein Problem nicht lösen kann/will,
dann negiert man es oder man "lagert es aus".
Also, schließen wir die Langläufer aus,
dann haben wir wieder Ruhe und brauchen (wieder) nichts tun!
So spricht ein wahrhaft professioneller Funktionär!
Ich sag': "Der geht weg, wie die Dirn vom Tanz"
-
2014-02-23 
Euer Weisenrat ist Euer Volk!! -
Fehlmann und Spindelberger - Ihr braucht keinen Weisenrat!
Ihr habt euer Volk!
Und das sagt euch klar was Sache ist ist -
nur ihr Zögerlinge werdet wieder nicht handeln,
sondern beraten, prüfen und "ausschussen".
SO werdet ihr schneller als euch lieb ist
zu dem, was ihr eigentlich jetz schon seid:
AUSSCHUSS!
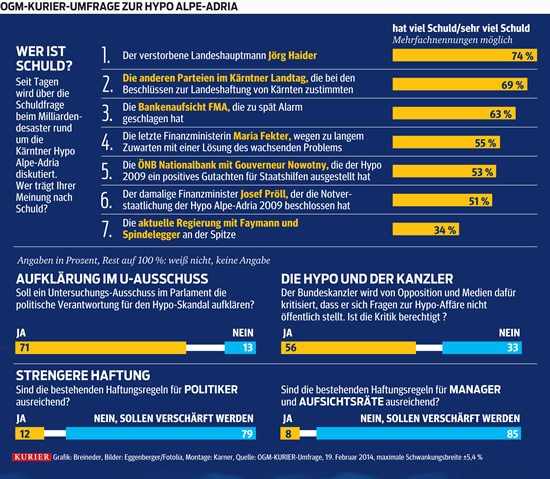
Der Kurier und OGM mögen mir verzeihen, wenn ich hier ein ©-right verletzen sollte,
aber diese perfekte Recherche musste ich einfach nochmal publizieren.
-
2014-02-23 
Keine Noten, keine Matura - lieber gleich ins burnout! -
Das hat Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek gerade noch gefehlt:
Der oberste AHS-Lehrervertreter Eckehard Quin (FCG) sieht keinen Sinn darin, dass es einerseits die Matura und andererseits immer mehr Aufnahmeprüfungen für Studienanfänger gibt. „Die Matura als allgemeine Studienberechtigung ist dann eigentlich keine Berechtigung mehr“, sagte Quin am Samstag im Ö1-Morgenjournal. Er kann sich ein einfaches AHS-Abschlusszeugnis vorstellen.
Umgehend konterte die Ressortchefin: Die Matura an sich infrage zu stellen ist „sehr befremdend“, sagte Heinisch-Hosek zur APA. Die Unterrichtsministerin verwies lieber auf die Vorteile der neuen Zentralmatura.
"Man kann durchaus über die Matura an sich diskutieren, also ob man nach acht Jahren Schule dann noch eine Prüfung braucht", so Rudas im APA-Gespräch.
-
2014-02-21 
Herr Schröcksnadel - nicht einmal Elmayer kann helfen! -
Jeder Tiroler Bergbauernbub hat mehr (Herzens-)Bildung als Sie!
Öfters schon ist es Ihnen gelungen, Ihre Kompetenzen in Frage zu stellen und
wieder ist es Ihnen geglückt, Inkompetenz zu beweisen.
"Do muass i sogn, des is leida noch a Partie, die sehr unprofessionell is ..."
Ja, genauso motiviert man Menschen!
Die "Unprofessionellen" haben Ihnen eine Antwort gegeben, die SIE, Herr Schröcksnadel, dorthin stellen, wohin Sie wirklich gehören -
in die Ecke der besserwissenden, nichtstuenden Funktionäre!
Gold und Bronze haben die Unprofessionellen geholt!
Und Sie, Herr Schröcksnadel, können (und werden) sich jetzt einbilden, dass Ihr "professioneller", unsäglicher Sager die Sportler zu diesen Superleistungen getrieben hat!
-
2014-02-19 
Neger?! - Mag. Albert SCHMALZ hat recht! -
Aufklären, auseinandersetzen!
Nicht verschweigen und schubladisieren!Der Philosoph Slavoj Žižek weist - m.E. äusserst zutreffend und wichtig - darauf hin, dass sich „politisch korrekte“ Begriffe abnutzten (die Ersatzbegriffe erben mit der Zeit die Bedeutung des Wortes, das sie ersetzen sollten), wenn sie nicht mit einer Veränderung der sozialen Wirklichkeit einhergingen.
So sei allein durch eine fortwährende Neuschöpfung von Ersatzbegriffen (wie in dem US-amerikanischen Beispiel Negro – black people – coloured people – African-Americans) noch keine Veränderung erzielt, wenn nicht den Worten eine tatsächliche soziale Integration folge.
Die rein sprachliche Prägung immer neuer Begriffe enthülle die Unfähigkeit, die tatsächlichen Ursachen von Rassismus und Sexismus allein durch Sprachpolitik zu überwinden.
So hat die - nunmehr nahezu kriminalisierte - Lehrerin völlig richtig gehandelt, als der offenbar veraltete (und von keiner der zahllosen Schulbehören entdeckte) Unterrichtsbehelf ein durch political correctness inkriminiertes Wort - Neger - enthielt.
Sie hat den Kindern erklärt, dass und warum dieser Begriff nicht verwendet werden soll, statt durch blosses Einziehen des Unterrichtsbehelfes die Problematik zu negieren/zu verschweigen.
Dass sich diese Lehrerin nun vor dem Stadtschulrat - der schlußendlich für diesen "Vorfall" die Verantwortung hat und diese auch tragen sollte - ist ein schlechter Witz.
Statt den Vorfall zu veruteilen, sollte der Wiener Stadtschulrat verhindern, dass veraltete Lehrbehelfe in den Schulen verwendet werden können. Da wäre eine Selbstverurteilung besser angebracht!
Gratulation und Dank an den Schuldirektor Mag. Albert SCHMALZ, der Vorgangsweise der Lehrerin als Problemlösungsansatz sieht und die Lehrerin verteidigt.
Solange sich nichts im Denken der Menschen ändert
ist umbenamsen nutzlos, Rassist kann man mit allen Vokabeln sein.
Wenn sich das Denken geändert hat,
ist es nicht mehr notwendig den Wortschatz von oben zu bestimmen.
-
2014-02-17 
Elmayer - fass!! -
Der Id... ist immer am anderen Ende der Leine!
Jeder ernstzunehmende Hundetrainer sagt es klar:
Ich trainiere nicht Hunde, ich trainiere ihre Menschen!"
So wäre also Herrn Elmayer zu raten, sich in die
Therapie eines ernsthaften Hundetrainers zu begeben.
Für die Sozialisierung eines Lebewesens ist es unabdingbar, dass der Umgang mit anderen Vertretern ihrer Speziesgelernt wird. Das geschieht aber nicht nur in der Schule, sondern auch - und viel wichtiger - am Spielplatz, wo in Freiheit geübt werden kann, wie man mit dem vis á vis umgehen kann/soll/muss.
Ein Hund der - auch in einer Hundezone - vorzugsweise an der Leine geführt wird (möglicherweise weil der Halter kein Vertauen zu seinem Hund - somit zu sich selbst - hat) kann kaum soziale Kontakte knüpfen/lernen, muss zwangsläufig agressiv werden.
Wird der Hundehalter vom Hund als mässig kompetent wahrgenommen (weil unsicher), dann wird der Hund dazu neigen, seinen "schwachen" Halter zu beschützen/zu verteidigen => zuzubeissen!
Nicht der Hund - der Mensch ist das Problem!
Die Sprache der Hunde zu lernen, ist Pflicht für jeden, der in einem Land mit über 800.000 Hunden lebt!
Die Stadt Wien unterstützt das Projekt schulhund.at, das offenbar eine Vorreiterrolle in Europa übernommen hat!
-
2014-02-14 
Valentinstag - make MONEY, not love! -
Runde 100 Millionen Euro spült der Valentinstag in die Kassen von Floristen, Chocolatiers und Juwelieren, aber auch Buch-und Teehandel sowie Fluglinien naschen Geschäft mit dem "Tag der Verliebten" mit.
Sogar Tierfutterproduzenten springen mit Werbung zum "ValenTIERStag" auf den Umsatzzug auf.
Das Linzer Marktforschungsinstitutes market hat ermittelt, dass 63% der Befragten den Valentinstag für eine unnötige, überaltete (es gibt ja auch genügend Neueres und Spannenderes: Halloween, Vatertag, den Tag des Meerschweins, ...) Einrichtung halten, die reine Geschäftemacherei sei.
Faune und Elfen umflattern die Blumen-, Herzchen- und sonstige Geschenke-Käufer, die dann ihren Blumenstrauss an jemanden überreichen - den sie möglicherweise gar nicht leiden können (aber es gehört sich halt) - und erhalten den geichen (weil im selben Geschäft gekauft) zurück.
Sinnvoll, toll und voller Liebe! oder??
Wäre es nicht sinnvoller, liebevoller und geldbeutelschonender z.B.
- ein Kinderhospiz
- die St. Anna Kinderkrebsklinik
- ein Altenheim
- die Gruft
- ....
aufzusuchen und dort Zuneigung, Lebensmut und Hoffnung zu schenken?
Gerne können Sie Blumen und/oder Schokolade mitbringen, vielleicht aber wäre es sinnvoller die obzitierten Einrichtungen mit einer saftigen Geldspende zu unterstützen!
-
2014-02-11 
13,000,000.000 € sinnvoll aufbringen! -

Kaum jemand hält sie für sinnvoll,
kaum jemand glaubt an ihre Wirtschaftlichkeit
- also lasst sie bleiben!
Die 13Mrd. € könnt ihr dann anders besser investieren
- ein Jahr lang 2,600.000 Kindergartenplätze finanzieren oder
- ein Jahr lang 288.888 Lehrer bezahlen oder
- die Uni's bei Einsatz der Drittmittel unterstützen
- oder, oder, oder ....
-
2014-02-10 
Universitäres Drittmitteldilemma -
An der Uni Wien haben sich die Drittmittel seit 2005 verdreifacht
bzw. seit 2007 um fast 70 Prozent erhöht.
SUPER! - könnte man sagen, aber
dies bringt aber auch Probleme mit sich, da das vom Bund zugewiesene Globalbudget bei Weitem weniger stark gestiegen ist.
Drittmittelfinanzierung belastet Uni-Budgets
Universitäten werden seit Jahren zur verstärkten Einwerbung von Drittmitteln angehalten. Zumeist bestehen diese in Fördergeldern der EU und des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
Doch diese fördern eben nur die reinen Forschungskosten und gelegentlich auch bis zu 20% der Verwaltungskosten.Die Infrastruktur muss hingegen von den Universitäten aus Eigenmitteln finanziert werden. Da jedes Drittmittelprojekt mit externem Personal einhergeht, das einen Arbeitsort und Arbeitsgerät benötigt, müssen die Universitäten hier mitunter draufzahlen. So sind etwa neue Büro- oder Laborräume zu schaffen oder teures Equipment bereitzustellen. Und auch reine Betriebskosten wie Heizung und Strom steigen aufgrund der Drittmittelprojekte spürbar an.
Die Universität Wien gab gegenüber der APA zum Beispiel an, zeitgleich mit der Steigerung der Drittmitteleinwerbung auch die Kosten für Geräteanschaffungen erheblich erhöht zu haben. Diese werden jedoch aus dem laufenden Budget beglichen und fehlen dann schlimmstenfalls bei der Durchführung der Lehrtätigkeit.Schon seit Anbeginn des Drittmittelbooms stehen im Gegensatz zu den Forschungszwecken gewidmeten Drittmitteln zudem solche von privaten Unternehmen stark in der Kritik, da diese neben den erhöhten Kosten der Infrastruktur insbesondere die Frage nach der Unabhängigkeit der Wissenschaft aufwerfen.
Bekannt sind solche Beispiele etwa aus der medizinischen Forschung, die in ihren Universitätskliniken nicht selten kaum erprobte neue Medikamente und Therapieformen im Rahmen klinischer Studien für die Pharmaindustrie durchführt und dabei ihre wissenschaftliche Reputation bewusst als Lockmittel einsetzt, um Probanden für die forschenden Unternehmen zu rekrutieren.
-
2014-02-09 
O alte Burschenherrlichkeit ... -
O alte Burschenherrlichkeit
Wohin bist du entschwunden?
Nie kehrst du wieder, goldne Zeit,
So froh und ungebunden!
So singen und sangen nicht nur Burschenschafter, sondern auch Corpsstudenten, Landsmannschafter, Sängerschafter und auch die Mitglieder des
österreichischen Cartellverbandes besser als CV bekannt.
All diesen "traditionsbekleckerten Verkleidern" wird - zur Aufklärung der Allgemeinheit - ein eigenes Kapitel gewidmet werden. Roland Girtler hat in der "Krone bunt" von heute einen einführenden Artikel über die Geschichte der Burschenschaften geschrieben, der einen Teil der "Aufklärung" darstellt. -
2014-02-01 
Pathologisierung der Kinder -
Geschätzte Frau Dr. Salomon,
herzlichen Dank für diesen Artikel!
Dass es für Kinder prinzipiell am gesündesten ist, in einer „normal“ funktionierenden Familie mit Geschwistern sowie leiblichen Eltern (ja, sie dürfen auch heterosexuell sein) zu leben, die für sie AUSREICHEND ZEIT haben (oder sich diese nehmen) wird ja auch durch die Diskussion über den Einfluss der Kinderaufbewahranstalten in Skandinavien und Frankreich untermauert.
Dass Sie dies auch so freimütig vertreten, scheint mir gefährlich für Sie.
Sie legen sich damit mit der Wirtschaft und ihren Hilfstruppen - den Verformern - an!
Passen Sie auf - halten Sie Ihren Rücken frei!
Die GesellschaftsVERFORMUNGStruppen (Genderisten, Feministinnen, Grüne und andere "Gutmenschen") leisten für ihre Auftraggeber - die Wirtschaft - hervorragende Arbeit.
Frauen, die sich selbstverwirklichen wollen (?), sind die kostengünstigsten Arbeitskräfte - weil weder die vorher zitierten Gruppen, noch die Legion von "Frauenministern" für gerechte Entlohnung der weiblichen Arbeitsbienen sorgen konnten oder - auftragsgemäß - nicht sorgen wollten.
Alleinerziehende Mütter, die aufgrund der beschämend schlechten Unterstützung durch unseren so hoch gelobten Sozialstaat gezwungen sind sich in prekäre Arbeitsverhältnisse zu begeben um Überleben zu können, sind für die Wirtschaft nicht ausreichend.
Somit muss durch den Ausbau von - möglichst ganztägigen - Kinderaufbewahranstalten (auf Kosten des Steuerzahlers) das Reservoir von kostengünstigen (weiblichen) Arbeitskräften stetig aufgefüllt werden.
Die u.A. daraus resultierende "Pathologisierung der Kinder" wird billigend in Kauf genommen, sind doch minder lebensfähige Jugendliche und Erwachsene auch eine gute Resource für schlecht bezahlte Arbeitskräfte.
Krude Verschwörungstheorie oder bittere Realität - das ist hier die Frage!?!
-
2014-01-31 
... und noch ein paar jobs für den Verfassungsschutz: -
Polizei verfolgt Spur zu Studenten-Politikerinnen
Krawalle: Kontakte von Wiener Studentenvertretern zur deutschen Szene werden untersucht.
Jene Anarchisten, die anlässlich des Akademikerballes eine Spur der Verwüstung durch die Wiener City gezogen hatten, hatten bereits Erfahrung bei Ausschreitungen in Magdeburg und Hamburg gesammelt. Doch wie kamen diese gut organisierten Randalierer auf das Ziel Wien? Und gab es eine „Einladung“ nach Österreich?
Bereits während der Besetzung des Votivparks im vergangenen Jahr wurden Verbindungen zu österreichischen Studentenvertreterinnen augenscheinlich. Damals war es deutschen Extremisten gelungen, per Megafon Asylwerber im Flüchtlingslager Traiskirchen zum Marsch nach Wien zu überreden. Beim anschließenden Protestcamp vor der Votivkirche agierten dann die Studentenvertreterinnen Julia Spacil (VSSTÖ) und Janine Wulz (GRAS) als Unterstützerinnen. Das Refugee-Camp war auch als Demonstrationsbasis gegen den damaligen WKR-Ball geplant, wurde aber wenige Tage vorher von der Polizei geräumt.
Auslandserfahrung
Spacil nutzte die vergangenen Monate, um in den Straßenschlachten in Magdeburg und Hamburg Demo-Erfahrung zu sammeln. Sie wurde mit eingekesselt und twitterte unter dem Alias-Namen „Schwarze Katze“ begeistert: „Berlin ist eh auch ganz nett ;) Aber im Ernst: Manchmal bin ich sogar ein klein wenig neidisch.“
Am 1. Jänner klagte sie deutschen Genossen: „Und mal wieder drängt sich die Erkenntnis auf: Wien ist einfach sterbenslangweilig.“
Einen Tag später jubelte sie: „Die FPÖ kriegt wieder Panik, weil zu den WKR-Protesten die ‚gefährlichen Linksextremisten‘ aus Deutschland kommen.“
Die waren dann auch tatsächlich da. Und Spacil spielte in Wien die Informationsdrehscheibe. Im Minutentakt verteilte sie – offensichtlich bestens informiert – Lagemeldungen.
Ein Auszug:
22:05: Museumsstraße Ecke Bellariastraße ist die Straße blockiert. Noch unstressig.
22:07: Blockade wird abgedrängt
22:09: Wieder blockiert, wieder geräumt, jetzt blockieren die selbst mit Wannen (Polizeifahrzeuge, Anm.)
22:14: 11 Wannen Richtung Oper.
Sie steuerte auch den Einsatz von privaten Sanitätern: „Mehrere Verletzte im Kessel Löwelstraße, DemoSani wär toll.“ Und von ihr kamen auch Abschlussanalysen: „Gestern hat auch gezeigt, dass man in Wien definitiv mehr und besser ausgerüstete Demosanis braucht.“
Aber insgesamt war sie mit dem Ergebnis zufrieden: „Gestern war für Wien dennoch eine neue Qualität, daher auch unerwartet.“
Die angerichteten Schäden vermerkte sie eher lapidar: „Einige Boutiquen am Graben und Hof entglast, riot cops, Kontrollen.“
Bei diesen „riots“ setzte sich auch Janine Wulz, Gefährtin aus den Refugee-Camp-Tagen und inzwischen Ex-ÖH-Vorsitzende, in Szene. Sie twitterte unter dem Alias-Namen „still fighting“, begleitete den „Schwarzen Block“ und führte wiederholt Gespräche mit dem Rädelsführer – auf Beobachter machte sie zumindest den Eindruck, dass sie die Meute anführen würde.
Das bestreitet Wulz gegenüber dem KURIER heftig: Sie habe im Juni alle politische Ämter zurückgelegt und hege keinerlei Sympathie für Gewalt. Sie habe als Privatperson den Zug begleitet und wollte allenfalls zwischen Demonstranten und Polizei vermitteln.
Autoritäres System
Nicht erreichbar für den KURIER war Julia Spacil.
In einem Interview mit einem Magazin distanzierte sie sich aber ebenfalls von jeder Art von Gewalt.
Ganz anderes klingt ihre Position aber in einer Twitter-Diskussion:
„Gewalt ist immer schlecht? Das stimmt so einfach nicht.
Welches autoritäre System wurde bisher weggekuschelt?“ -
2014-01-31 
... ein job für den Verfassungsschutz: -
... der Verfassungsschutz, die Staatsanwaltschaft, die Polizei ...
- sollte überprüfen ob der Akademikerball tatsächlich
... wenn ja, dann könnte man den Ball verbieten und damit
ein rechtsextremes Vernetzungstreffen ist
- die Hofburg "befreien",
- der FPÖ eine öffentliche Plattform des Selbstmitleids entziehen und
- Demonstranten jeglicher Gesinnung die Begründung für Demonstrationen nehmen.
... wenn nein, dann müßte man fairerweise Demonstrationen dagegen nicht zulassen und
auf die Gefahr von Verleumdungsklagen hinweisen.
-
2014-01-30 
Wer braucht eigentlich die Hochschülerschaft? -
Holt diese "Talente" nicht in die Politik!
Die ÖH darf politisches Experimentierfeld sein.
Aber einige Studentenvertreter haben stark überzogen.
Wer braucht eigentlich die Hochschülerschaft? Prinzipiell hat sie zwei Funktionen, offiziell aber nur eine: Sie vertritt die Interessen der Studenten (Pflichtmitgliedschaft!). Sie ist aber auch eine Gehschule für die "große" Politik. Ersteres hat die linke Koalition in den letzten Jahren eher schlecht erledigt, obwohl es genug zu tun gäbe. Die Studienbedingungen werden immer schlechter. Interessiert die ÖH aber nur am Rande, weil sie in erster Linie Gesellschaftspolitik im Sinn hat, und da geht es um die Verbesserung der Welt. Wobei für den akademischen Nachwuchs – speziell in Wien – nichts wichtiger zu sein scheint als "feministisch-queere" Projekte. ("Queer" bedeutet hier: alles, was nicht der heterosexuellen "Norm" entspricht.)
Dazwischen agitiert man gegen "Rechts". Das ist legitim (auch wenn dabei echte studentische Anliegen vernachlässigt werden), solange das Ganze im rechtsstaatlichen Rahmen bleibt. Studentenpolitik darf bis zu einem gewissen Grad ja auch Experimentierfeld sein und muss nicht immer todernst betrachtet werden.
Bei den Demos gegen den Akademikerball der FPÖ und der Burschenschaften (traditionelle Studentenkorporationen) zeigten sich aber ziemlich antidemokratische Tendenzen unter den wackeren Antifaschisten in der ÖH: Würden FPÖ-nahe Studenten so leichtfertig gewaltsame Auseinandersetzungen befürworten, dann gäbe es helle Aufregung in heimischen Medien.
Sehr glimpflich kam die ÖH auch schon bei der Versenkung einer halben Million Euro (!) für das "antikapitalistische" Café Rosa davon. Für beides zeichnet u. a. die Grüne Janine Wulz verantwortlich, die bis 2012 ÖH-Vorsitzende und bis Juni 2013 Stellvertreterin war.
Sollten sich die Parteien also tatsächlich um Nachwuchs im Talentepool ÖH umsehen:
Bitte holt sie und ihre Freundinnen nicht!Dr. Martina Saomon ZKURIER) ERSTELLT AM 30.01.2014, 20:00
-
2014-01-28 
... ja, ich geb's ja zu, ich mag den Pilz nicht, ABER ... -
... die folgenden Zitate aus dem Standard sind für mich "beziehungsfördernd";
Der Abgeordnete Peter Pilz ist stinksauer, und er rät jenen, die sich mit der Abgrenzung von Gewalt schwertun:
"Wer jetzt gehen will - adieu. Und nicht 'Auf Wiedersehen'."
Dem Nachwuchs rät er: "Gerade eine grüne Partei braucht junge Grüne, die vor fast nichts Respekt haben, am wenigsten vor einem Parteivorstand.
Aber für uns alle gilt die Grenze, ab der nichts mehr grün ist.
Und das sei eindeutig:
"Es gibt eine Grenze, und die heißt 'Gewalt'. Wer sie überschreitet, gehört nicht zu uns."
Pilz schreibt in seinem Blog, dass er endgültig genug davon habe, "dass ein paar Jungfunktionäre Jahr für Jahr dieselbe Frage aufwerfen: Wie halten es die Grünen mit Gewalt?
Diese Frage ist seit unserer Gründung beantwortet."
Er könne auch nicht verstehen, wie die Parteiführung oder andere Mandatare in dieser Frage so herumlavierten.
Meint er damit vielleicht den Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser, der mit "Unseren Hass den könnt Ihr haben" nichts anfangen kann und nicht in der Lage/Willens ist, sich von Gewalt eineindeutig zu distanzieren?
Oder vielleicht die Mitveranstalterin einer der Demonstrationen gegen den Ball, Natascha Strobl, die sich nach mehrfacher Frage von Frau Thurnherr ebenfalls nicht eineindeutig von Gewalt distanzieren wollte? 2014-01-28
-
2014-01-27 
Glawischnig verspätet zum Akademikerball ... -
Eva Glawischnig hat sich nicht zum Akademikerball sondern zu den Ereignisen vom 24./25.01 verspätet - nämlich am 27.01.2014 um 03:27 via Facebook - geäußert:
WKR-Ball
FPÖ-Chef Strache und FPÖ-Spitzenkandidat Mölzer tragen die Verantwortung dafür, dass die Nachfolgeveranstaltung des WKR-Balls - der als solcher nicht mehr in der Hofburg stattfinden hätte können – nun neu als "Akademikerball" in der Wiener Hofburg stattfinden konnte.
Es ist eine bewusste Inszenierung und Provokation der FPÖ, dieses Treffen von Vertretern des europäischen politischen Rechtsextremismus in der Hofburg zu veranstalten.
Zur Homepage-Domain der Jungen Grünen:
Gewaltfreiheit ist ein Grundwert grüner Politik.
Die Grünen lehnen daher auch jegliche Nähe zu Gewalt auf friedlichen Demonstrationen entschieden ab.
Es ist bedauerlich und schadet dem wichtigen Anliegen des Antifaschismus, dass die Jungen Grünen Inhaber einer Domain sind, deren Inhalte sie nicht kontrollieren.
Ich erwarte mir von den Jungen Grünen eine Garantieerklärung, dass sichergestellt wird, dass in Zukunft nicht länger Inhalte von Dritten auf Domains der Jungen Grünen veröffentlicht werden.
Die von der FPÖ gegenüber den Jungen Grünen angekündigte Klage ist absurd. Die Jungen Grünen haben sich immer von jeder Form der Gewalt distanziert.
-
2014-01-27 
Der WKR-Ball, die Grünen und das Dilemma -
Efgani Dönmez - Mitglied des Bundesrates, entsendet durch den oberösterreichischen Landtag

Das Dilemma der Linken, insbesondere der Grünen wird jedes Jahr rund um die Veranstaltung des WKR-Balles sehr deutlich, wenn man bestimmte Puzzleteile aneinanderfügt.
Erinnern wir uns an den Sommer 2013 zurück, wo Pro-Erdogan Demonstranten in Wien demonstrieren gingen und ich dazu klar Stellung bezogen habe und mir manche der eigenen “ParteikollegInnen” in den Rücken gefallen sind, indem sie mir das Wort im Mund umgedreht haben, wie z.Bsp: Landessprecher der Wiener Grünen Georg Prack, welcher wortwörtlich gesagt hat:
“PolitikerInnen können auch mal emotional sein und beim Thema Menschenrechte bin ich emotional.”
oder die Aussage des Bundesgeschäftsführers Stefan Wallner:
“…wir können nicht gleichzeitig Zwangsmaßnahmen für hier lebende Andersdenkende fordern … Meinungsfreiheit ist ein zentraler Wert einer Demokratie, den wir verteidigen…”
Offensichtlich werden diese nur jenen zuerkannt, welche politisch opportun sind, national-islamistische Strömungen, welche auf Wiens Straßen, wir sind “Soldaten Erdogans” skandieren, fallen aus Grüner Sicht unter Meinungsfreiheit und Menschenrechte,
aber wenn Ball-Besucher mit einem deutschnationalen Weltbild und sonstigem rechten Gedankengut diesen besuchen, dann wird dagegen massiv gewettert und versucht dies mit (fast) allen Mitteln zu bekämpfen.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich hege weder Sympathie für islamistische Strömungen noch für nationalistische Gesellschaftsvorstellungen, aber was mir bitter aufstößt ist die Doppelmoral, welche aus der Linken, insbesondere aus den eigenen Reihen entgegenschlägt.
Die Doppelmoral, scheint so zu sein, dass zur Aufrechterhaltung eines ideologischen Weltbildes direkt proportionale Außenfaktoren die entscheidende Rolle spielen:
Ohne FPÖ keine antifaschistische Gesinnung.
Ein indirekt proportionaler Grund dafür dürfte auch sein, dass die Demonstrationen samt Gewaltanteil immer stärker werden, je geringer die Zahl der Ballbesucher wird.
Deutlich ersichtlich an den zwei angeführten Beispielen, paradoxer geht es kaum mehr, dies ist unter anderem das Dilemma in dem die Linke in Österreich steckt…
Efgani Dönmez – Mehr Mut in der Politik.
-
2014-01-27 
Glawischnig und die Doppelmoral -
Glawischnig droht dem Nachwuchs
Quelle: Kurier vom 2014-01-27
Auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig nahm ihren Parteinachwuchs in die Pflicht:
Sie verlangte im Rahmen der Jahresauftaktklausur in Mauerbach eine "Garantie-Erklärung", in der sich die Jungen Grünen von allen Gruppen, die vor Gewalt nicht zurückschrecken, distanzieren.
Auch die Verpflichtung, dass künftig niemand mehr auf einer ihrer Homepages etwas posten kann, ohne dass sie die Kontrolle darüber behalten, forderte sie. Andernfalls würden sie nicht mehr als grüne Jugendorganisation benannt - eine Rauswurfdrohung also. Der Eklat wurde schließlich noch abgewendet.
Anfangs hatte Bundessprecher Cengiz Kulac die geforderte Garantieerklärung abgelehnt und Glawischnig via derstandard.at "schlechten politischen Stil" attestiert.
Die Gewalt der Demonstranten bezeichnete Glawischnig als "absolutes Desaster".
"Ich habe absolut null Verständnis für jemanden, der das nicht gewaltfrei macht", erklärte sie. Gewalt sei "absolut daneben" und schade den berechtigten Anliegen der friedlichen Demonstranten. Das wiederholte die Grüne Frontfrau auch in der ZiB2 am Montag.
Nicht eingehen wollte Glawischnig auf den Vorwurf der "Doppelmoral" der Partei, geäußert vom Grünen Bundesrat Efgani Dönmez. (s.u. "Der WKR-Ball, die Grünen und das Dilemma)
Darauf angesprochen, bekräftigte Glawischnig ihre Kritik am Akademikerball - dass damit die "Prunkräume der Republik" in Nähe zum Bundespräsidenten zum Treffpunkt Rechtsextremer aus Europa würden. Sie hätte nichts dagegen, wenn sich die Rechten in Bierzelten treffen, aber gegen eine solche "Provokation" müsse man ein Zeichen setzen.
-
2014-01-25 
Akademikerball, noWKR und die jungen Grünen -
Eigentlich wollte ich keien weitere Werbung für den braunen Blauen machen, aber Ungerechtigkeit mag ich nicht!
Eine demokratisch gewählte Partei - dass sie die drittstärkste politische Kraft im Lande ist mag man bedauern - hat zweifelsfrei das Recht Veranstaltungen - auch auf "symbolträchtigen Orten im Herzen der Republik" - abzuwickeln.
Dass besorgte Mitmenschen das Recht haben, ihrer Besorgnis auch durch Demos Ausdruck zu geben, ist demokratisch gut und richtig.
Dass diese beiden Aktivitäten zu Millionenschäden in Wien führten, ist den obangführten Gruppen NICHT anzulasten!
Dass aber ausgerechnet die jungen grünen mit der Domain "noWKR.at" den kriminellen Chaoten eine Organisationsplattforn zur Verfügung stellen, stimmt mich höchst bedenklich!
In demokratiepolitischer Hinsicht sollte man die "Mittäterschaft" der jungen Grünen durch Schadenersatzleistungen ahnden.
Dass die "Distanzierung" der jungen Grünen ein "interessanter" Umgang mit der Wahrheit ist, zeigt sich hier!
-
2014-01-24 
Akademikerball - na und? -
Fritz Henkel hatte seinen Mitarbeitern verboten den Namen von Konkurrenten auszusprechen,
weil dies Werbung und Reklame für jene sei!
Warum machen Medien, Gutmenschen u.v.a. unbezahlte WERBUNG für die Rechten und die FPÖ?
Die Veranstaltung zu ignorieren, totzuschweigen wäre allemal der bessere Weg!
So aber schafft man der FPÖ und den Rechten unbezahlte Werbung (Lugner schau oba!)
und gibt linken Chaoten und deren Importen aus Deutschland eine Plattform für Randale!
-
2012-02-11 
Faymann und Spindelegger haben gekreißt: ein Mäusewunschpaket wurde geboren! -
Ich bin gerührt - sie haben einander wieder lieb!
"Wir haben nicht das Trennende gesucht, sondern das gemeinsame gefunden." (Faymann)
"Die vergangenen zehn Wochen waren die härtesten in meinem Leben." (Spindelegger)
Sie loben einander, sie loben sich - aber was haben sie wirklich zu Stande gebracht?
+ niedrigere Gehaltserhöhungen für Beamte
- für die Nulllohnrunde 2013 und die "moderate Gehaltsanpassung" 2014 müssen sie erst mal am Neugebauer vorbei!
+ niedrigere Erhöhung der Pensionen
? hoffentlich werden die Kleinen mehr bekommen als die Grossen!
- wo bleibt die Solidarabgabe für Spitzenpensionen?
0 Frühere Harmonisierung der Pensionssysteme
? was kann das?
+ Strengere Regeln für den Gang in die Frühpension
+ Strafzahlung für Unternehmen bei Kündigungen
0 Altersteilzeit darf nicht mehr geblockt werden
? wem oder was bringt das etwas?
+ Höhere Pensionsbeiträge für Bauern & Selbstständige
++ Immobilienverkäufe und Umwidmungsabgabe
+ Bauern müssen Mineralölsteuer bezahlen - das bringt 320 Mio. p.a.
- Besserverdiener zahlen einen Solidarbeitrag - das bringt matte 440 Mio.
ein eher schwacher Beitrag wenn man Vorsorgekürzungen (172 Mio.) und Bausparprämienhalbierung (304 Mio.)
damit vergleicht! Bei den untenstehenden Bezügen muss man ja vorsorgen und Bausparen !!
- bei über 182.000 p.a. eine Solidarabgabe von 320€ (?!?) - das nenne ich eher Taschengeldentzug! (1,76%)
- ab 500.000€ p.a. sind sogar 11.500€ oder 2,3% fällig, bei diesem Einkommen ebenfalls s.o.!
die Betroffenen, ca. 20.000, verdienen mehr als 13.200€ p.m.
wäre da nicht eine niedriger Grenze richtiger? Aber dazu fehlte wohl ein wenig Mut!
- Prämie für Bausparen und Privatpension wird halbiert
- Zukunftsvorsorge wird einmal mehr an den Staat rückdelegiert!
Eine weise Entscheidung, die wieder die eher "kleinen Leute" trifft!Der geneigte Leser mag für sich entscheiden ob das nun eine Mäuslein-, Maus- oder gar Rattengeburt war
und abwarten was unsere Volksvertreter am 9.März dazu befinden werden!
Offen bleibt auch noch, wie dieses "Packerl" den Landesfürsten schmecken wird!2012-02-10 
"Freiheit" im Internet? - Eigenverantwortung 0! - Google bietet Internetusern für 20 $ im Monat ihre gesamte Internetnutzung beobachten zu lassen und das obwohl der Konzern mit seinen geänderten Nutzungs Bestimmungen ohnehin gerade dabei ist, von jedem User ein Profil anzulegen.
Nun gibt es wenigstens Kohle für die Entblößung des eigenen ich's!
Zusätzlich zur "pubertären Netzdiarrhö Facebook" (© Andreas Schwarz / Kurier, dem ich hier herzlich für die treffendste Definition von Facebook danke!) von dem deren Gründer Marc Zuckerberg sagt:
"unser Erfolg ist es, wenn wir Menschen helfen, all das von sich preiszugeben, was sie möchten",
damit er das Preisgegebene an die Werbewirtschaft um Milliarden verhökern kann.
Ich wünsche allen Netz-Exhibitionisten - ich glaube sie wissen nicht was sie tun - weiterhin ihr Vergnügen!
Meinereins wird versuchen, nur das preiszugeben, was ICH für richtig halte! Quelle: www2012-02-10 
Flachmann und Schwindelberger haben und hatten Probleme miteinander. - Hinter verschlossenen Türen und unter strengster Verschwiegenheit wollten sie "das Ruder herumreissen" und und das Staatsschiff wieder in sichere Gewässer mit 10 Mrd. € unterm Kiel bringen.
Doch dann grub rote Haut Flachmann das Kriegsbeil Klassenkampf aus, um seine Stammesmitglieder zu befriedigen.
Schwindelberger war erbost!
Auch er war seinen schwarz(afikanischen - um politisch korrekt zu bleiben) Stammesbrüdern im Wort, sie nicht zu sehr bluten zu lassen.
Während der eine nach neuen EINnahmen suchte, war der andere auf der Jagd nach EINsparungen.
Verschwiegenheit ade!
Wir diskutieren - wie auch früher - über die Medien!
Und die Verhandlungen stehen still - weil irgendein starker Arm es will ;-)
So treibt das antriebslose Schiff auf die Gewässer der Hard Core - Küste zu, wo ER sich erfreut die Hände reibt und immer berechtigter auf den Kanzlersessel schielt, nein bereits ganz offen schaut!2012-01-09 
Bravo ORF-Mitarbeiter!
1.300 unterschreiben einen Protest, Redakteure drehen ein Video!
1.300 ORF-Mitarbeiter haben einen Aufruf für einen unabhängigen ORF unterschrieben.
Allem voran wird die undurchsichtige Nominierung von Niko Pelinka zum Büroleiter von Alexander Wrabetz
- dessen Bestellung sie einen Tag vor Weihnachten aus der Zeitung (!) erfuhren - zum Hauptpunkt ihres Protestes.
Die ZIB-Journalisten drehten PRIVAT ein Protest-Video und veröffentlichten dieses auf YouTube:
2011-11-30 
... ich werde zum politisch unkorrekten Wutbürger! - Österreich ist meine Heimat und ich liebe dieses Land!
Obwohl die meisten Österreicher "Suderer" (© Alfred Gusenbauer) sind, die Wiener (auch ich bin einer) zu Recht als "Raunzer" bekannt sind, gibt es erstaunlich viele Menschen in diesem Land, die etwas ÄNDERN wollen!
Und auch deshalb liebe ich dieses Land und seine Menschen!
Denke ich aber an unsere Angestellten, von denen viele gierig und korrupt (es gilt natürlich die "Unschuldsvermutung") sind, dann "geht mir in der Tasch'n der Feit'l (rurales Klappmesser mit Holzgriff) auf"!
Diese Leute haben - im Gegensatz zu Menschen - offenbar völlig vergessen, wer ihre Chefs sind und von wem sie bezahlt werden!
Viele Politiker aller Coleur bedienen sich ungeniert aus unseren Steuergeldern, geben diese auch ungehemmt für ihre persönlichen Denkmäler (z.B. Spitäler in einem Abstand von 4km!! Kittsee und Hainburg: Zwei vollwertige Spitäler, vier Kilometer voneinander entfernt!!! – und das nur, weil das eine im schwarzen Niederösterreich und das andere im roten Burgenland steht) aus und werben unverschämt für sich!(Kosten für Regierungswerbung
Die Ausgaben der Regierung für Öffentlichkeitsarbeit haben sich nach Angaben der Grünen innerhalb von zehn Jahren mehr als vervierfacht.
Das gehe aus diesbezüglichen parlamentarischen Anfragebeantwortungen hervor.
Laut dem Abgeordneten Karl Öllinger habe man dabei im vergangenen Jahr 2010 einen Spitzenwert von rund 42,3 Mio. Euro erreicht, was allein einer Steigerung zu 2009 um mehr als 40% entspreche.
Er qualifiziert dies als "pure Verschwendung". )
Die Gemeinde Wien mit ihrer rot-grünen Koalition kann es offenbar noch kecker Wien-Wahl: Gemeinde Wien verpulvert 15 Millionen an Zeitungen
Quelle: sosheimat.wordpress.com / 2010-08-01
Geschätzt 15 Millionen Euro pumpen die Gemeinde Wien und deren Betriebe jährlich in "Kronen Zeitung", "Österreich" und "Heute" –
zum Nutzen der Stadt-SPÖ, zum Nachteil der Steuerzahler.
Insgesamt, so die Schätzungen der Oppositionsparteien, geben die Gemeinde Wien und ihre Unternehmen (wie Wiener Wohnen, Wien Energie,…) jährlich zwischen 80 und 100 Millionen Euro für Werbung aller Art aus – doppelt so viel wie die Bundesregierung. als die Bundesregierung!
Seit die Grünen in der Stadtregierung sind sie wirklich "sozial(listisch)" geworden!
Nur so kann man sich die Zustimmung zu einem unerhörtem Belastungspaket erklären!
erklären!
Sie sollten vor Scham noch röter werden, als sie offenbar ohnedies schon sind!!
Sie begründen ihre Zustimmung mit Steuerungseffekten Der Grüne Kogler legt die Untergrenze für Vermögenssteuern mit 500.000 € fest, während selbst die Roten 1,000.000 € als Untergrenze sehen!!(Kurier 2011-11-20)
Die Grünen sind wenigstens ehrlich. Sie wollen eine Vermögenssteuer ab einem "Reichtum" von 500.000 Euro einheben.
Aus der Lektüre des stets fein gemachten IMMO-KURIER geht freilich hervor, dass man um eine halbe Million in österreichischen Großstädten kein Palais, sondern bestenfalls eine mittelgroße Eigentumswohnung bekommt.
Das heißt, die Steuerpläne der Grünen treffen natürlich den viel zitierten Mittelstand, dafür würden sie auch wirklich einige Milliarden Einnahmen bringen.(Helmut Bandstätter / Kurier 2011-11-22)
Die Hundesteuer wird in Wien von 43,60 € um 65% (!!!) erhöht, 70,00 € sollen der neue Tarif sein!(Kurier 2011-11-22)
Da werden sich ärmere und ältere Menschen aber freuen, die als einzigen Freund ihr Hunderl haben!
Die Parkgebühren steigen um 66%!
Die Pendler und alle anderen, die aus beruflichen oder privaten Gründen auf die tägliche Benutzung ihres Fahrzeuges angewiesen sind, bedanken sich bei der grünen Verkehrsstadträtin Vassilakou! .
Das mag ja bei den Parkgebühren noch zutreffen - aber sollen wir weniger heizen (und frieren) oder weniger duschen (und stinken) oder den Müll im Dunkeln (Strom wurde/wird ja auch teurer) im Freiland entsorgen?
"Wir wollen mit diesen Maßnahmen vor allem einen Lenkungseffekt erzielen", sagt die grüne Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou zu ihrer Reform.
Wie war das mit dem Lenkungseffekt vor ca. 11 Jahren?
"Wenn der Sprit die 20.- ATS Marke erreicht hat, wird der Individualverkehr deutlich abnehmen!"
Aber hallo! - wieviel sind denn 1,53 Euronen in ATS, Herr Prof. van der Bellen????? Etwa 21,05 ATS ???
Das nenne ich "grüne, sozialverträgliche Steuerung"! - oder sollte es doch BEsteuerung heissen?2008-06-12 
"Genderwahnsinn" in Schulbüchern

"Genderwahnsinn" in Schulbüchern Elternvertreter laufen Sturm gegen geschlechtergerechte Formulierungen in österreichischen Schulbüchern. Die Lesbarkeit müsse an erster Stelle stehen.
Elternvertreter laufen Sturm gegen geschlechtergerechte Formulierungen in österreichischen Schulbüchern. Die Lesbarkeit müsse an erster Stelle stehen.
12.01.2015 | 10:00 | Von Bernadette Bayrhammer (Die Presse)
Wien. „Arbeitet zu zweit“, heißt es in einem Deutschbuch: „Eine/r ist Zuhörer/in, der/die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor, der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte zusammen.“ In den (neueren) österreichischen Schulbüchern wird auf geschlechtergerechte Sprache Wert gelegt – und zwar zu viel Wert, wie Elternvertreter finden. Sie laufen nun Sturm gegen den „Genderwahnsinn“, den sie in den Unterrichtsmaterialien orten.
Gendern oder nicht gendern? Diese Frage polarisiert, so viel ist seit der jüngsten Binnen-I-Debatte klar, bei der eine Reihe prominenter und weniger prominenter Persönlichkeiten gegen die geschlechtergerechten Formulierungen zu Felde gezogen ist. Die Verständlichkeit von Texten solle „wieder den Vorrang vor dem Transport feministischer Anliegen eingeräumt bekommen“, hieß es damals.
Ähnlich argumentieren auch die Eltern: In den Schulbüchern fehle durch das Gendern bisweilen die Lesbarkeit, kritisiert Theodor Saverschel, der die Eltern der Schülerinnen und Schüler an den mittleren und höheren Schulen vertritt, im Gespräch mit der „Presse“: „Hauptsache, es ist gendergerecht.“ Das sei nicht akzeptabel.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich Schüler beim sinnerfassenden Lesen bisweilen ohnehin schwertun, sieht er Schreibweisen wie „Zuschauer/-innen, Spezialist/ -innen – meist Ärzte/-innen im weißen Kittel“ (aus einem Psychologiebuch) als Problem. „Es gibt schon so genügend Leseschwierigkeiten“, so Saverschel. „Diese werden so noch verschärft.“
Lesbarkeit berücksichtigen
Der Elternvertreter ortet einen Widerspruch zu den Kriterien, nach denen Schulbücher abgesegnet werden. Damit neue Bücher freigegeben werden, müssen sie zwar die „Gleichbehandlung von Frauen und Männern“ und die „Erziehung zur partnerschaftlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Entwicklungen“ ausreichend berücksichtigen. Ebenso aber müssen die „sprachliche Gestaltung“ und die „gute Lesbarkeit“ berücksichtigt werden.
Kein Binnen-I in Volksschule
Das Bildungsressort empfiehlt in seinem Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren, bis in die Unterstufe Binnen-I und Schrägstrich (wie Schüler/in) zu vermeiden. In Sprachlehrbüchern sollten die vollständigen männlichen und weiblichen Formen gelehrt werden. In anderen Schulbüchern könnten die „üblichen Formen“ der geschlechtergerechten Schreibweise verwendet werden, heißt es. Allerdings: Auch hier ist „auf Verständlichkeit, Lesbarkeit und Sprachrichtigkeit zu achten“.
Die Eltern fordern vom Bildungsressort, die geschlechtergerechte Schreibung mittels Schrägstrichs genauso wie das umstrittene Binnen-I aus allen Schulbüchern zu verbannen. „Stattdessen können geschlechtsneutrale Formen verwendet werden“, sagt Saverschel. „Man kann auch die weibliche und die männliche Form abwechselnd verwenden oder nur die weibliche Form“, sagt Saverschel. „Lesbarkeit muss Priorität haben.“
Bis dahin appelliert er an die Elternvertreter an den einzelnen Schulen, an die Lehrenden sowie die Schülerinnen und Schüler: Nachdem sie es sind, die im Schulgemeinschaftsausschuss über die Auswahl der Schulbücher mitentscheiden, sollten sie in Zukunft nur noch solche Unterrichtsmaterialien bestellen, bei denen die Lesbarkeit gegeben sei, so Saverschel.
Schlechte Noten?
Die Eltern haben noch weitere Befürchtungen, was das Gendern in der Schule angeht: dass künftig womöglich auch bei Schularbeiten und Maturaangaben geschlechtergerechte Formulierungen verwendet werden (müssen) – und diese dann zum Nachteil der Schüler noch komplizierter werden. „Und wie wird das in Zukunft bei der Bewertung aussehen?“, fragt Saverschel. „Gilt es dann als Fehler, wenn in einer Schularbeit nicht durchgehend gendergerecht formuliert wird?“
("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2015)
 Binnen-I im Schulbuch: Eltern wehren sich Apa | 12.01.2015 - 15:16
Mit Schrägstrichen zerhackte Wörter oder Binnen-I im Text: Elternvertreter kritisieren Gender-gerechte Schulbücher. Sie seien schwer lesbar.
Binnen-I im Schulbuch: Eltern wehren sich Apa | 12.01.2015 - 15:16
Mit Schrägstrichen zerhackte Wörter oder Binnen-I im Text: Elternvertreter kritisieren Gender-gerechte Schulbücher. Sie seien schwer lesbar.
Der Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen spricht sich gegen Gender-gerechte Schulbücher aus. "Ein Schulbuch ist dazu da, um von Schülern verstanden und gebraucht zu werden sowie Lehrinhalte zu vermitteln", so der Verbands-Vorsitzende Theodor Saverschel bei einer Pressekonferenz am Montag. Das Gendern führe dagegen zu zunehmender Unleserlichkeit der Texte.
"Arbeitet nun zu zweit. Lest den rechts stehenden Text (S.7) folgendermaßen: Eine/r ist Zuhörer/in, der /die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor, der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte zusammen. Der/die Vorleser/in muss angeben, ob die Zusammenfassung richtig war. Wechselt euch nach jedem Textabschnitt in der Rolle ab". Solche Passagen wie in diesem Deutsch-Lehrbuch sind für die Elternvertreter wenig hilfreich. Seit 2012 werden auch nur mehr Schulbücher approbiert, deren Inhalt geschlechtsneutral verfasst ist.
"Lesen ist ein sehr komplexer Vorgang", argumentierte Saverschel. "Beim Lernen und Üben ist es wichtig, dass die Worte rasch erfasst werden. Durch das Zerhacken mit Schrägstrichen wird das so gut wie unmöglich gemacht." Gerade für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache müsse man darauf Bedacht nehmen, dass sowohl Form als auch Inhalt der Texte gut verständlich seien, so seine Stellvertreterin Susanne Schmid.
Seit 2012 gibt es einen Leitfaden des Bildungsministeriums, wie Schulbücher verfasst sein sollen. Darin heißt es, dass in Sprachlehrbüchern grundsätzlich die "vollständigen Paarformen" gelehrt werden sollen (männliche und weibliche Form - entweder durch "und" oder durch Schrägstrich verbunden z.B.: Schüler und Schülerinnen bzw. Schüler/Schülerinnen), ab der Oberstufe sollen dann auch die "Sparschreibungen" thematisiert werden (Schrägstrich innerhalb eines Wortes: "Schüler/innen" oder etwa Binnen-I: "SchülerInnen"). In anderen Schulbüchern "können die in der Öffentlichkeit üblichen Formen der geschlechtergerechten Schreibweise verwendet werden, wobei auf Verständlichkeit, Lesbarkeit und Sprachrichtigkeit zu achten ist".
"Was hier unter Verständlichkeit verstanden wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht", meinte Saverschel. Diese Vorgangsweise habe auch kein anderes deutschsprachiges Land gewählt. "Das ist ein österreichisches Schulbuchproblem", meinte Schmid. Sie appellierte an die Elternvertreter an den Schulen, bei der Beschlussfassung im Schulgemeinschaftsausschuss über die zu verwendenden Schulbücher auf die Lesbarkeit zu achten. Derzeit gebe es noch durchaus ungegenderte Schulbücher - erst Neuauflagen würden gegendert.
Die Elternvertreter sind aber nicht grundsätzlich gegen geschlechterneutrales Formulieren: "In öffentlichen Papieren, im rechtlichen Bereich - etwa bei Ausschreibungen - ist das durchaus notwendig. Aber Schulbücher sollten von der Vernunft getragen sein", so Schmid. "Zeitungen oder Theaterstücke werden ja auch nicht gegendert."
"Entscheidend ist immer die Lesbarkeit", meinte Saverschel: "Wenn man allgemeine Formen findet wie etwa 'Studierende' - von mir aus, dann ist das auch in Ordnung." Problem für ihn: "Political Correctness wird oft als Feigenblatt verwendet, um Aktionen umzusetzen, die bar jedes Hausverstandes sind. Das schadet dem Bildungsstandort und erweist der Frauenförderung einen Bärendienst."
Frauenförderung besteht für Schmid vielmehr in der Schaffung gleicher Chancen. So müsse man sich etwa fragen, warum Mädchen sich oft weniger für naturwissenschaftliche Fächer interessieren oder bei Mathe-Schularbeiten wie zuletzt bei der Modell-Schularbeit für die Zentralmatura schlechtere Ergebnisse erzielen. Hier müsse stärker gefördert werden: "Da reicht ein Tag der offenen Tür mit 15 nicht."
Weitere Befürchtung der Elternvertreter: "Es ist ja schon abzusehen, dass sich das Gendern auf Aufgabenstellungen bei Schularbeiten oder Matura ausweiten wird", so Schmid. So stelle sich die Frage, ob künftig Schüler schlechter benotet werden, die nicht gendern - etwa bei der vorwissenschaftlichen Arbeit bei der Matura oder der schriftlichen Matura selbst.
Im Bildungsministerium verteidigte sich. "Es werden jene Schulbücher genehmigt, die die Genderaspekte ausreichend beachten", hieß es gegenüber der APA. "Das beinhaltet auch eine geschlechtergerechte Sprache, da sowohl Mädchen als auch Buben sich angesprochen fühlen sollen. Gendergerechte Sprache und Lesbarkeit schließen einander nicht aus."
Zeit für eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität
800 Sprachkritiker gegen die Zerstörung der Sprache durch Binnen-I und andere von oben verordnete Verunstaltungen.
(Die Presse)
Sehr geehrte Frau Minister Heinisch-Hosek, sehr geehrter Herr Minister Mitterlehner!
Die gegenwärtige öffentliche Diskussion zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern veranlasst die unterzeichnenden Linguisten, Germanisten, Hochschul-, Gymnasial- und Pflichtschullehrer, Journalisten und Schriftsteller, aber auch andere Personen des Gesellschaftslebens, dringend eine Revision der gegenwärtigen Vorschriften zu fordern. Es ist Zeit für eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität.Die derzeit durch den Frauenförderungsplan von oben her verordnete konsequente getrenntgeschlechtliche Formulierung zerstört die gewachsene Struktur der deutschen Sprache bis hin zur Unlesbarkeit und Unverständlichkeit. Man versuche zum Beispiel nur §2 des Bundesgleichbehandlungsgesetzes zu lesen und zu verstehen. Die Verpflichtung zur generellen getrenntgeschlechtlichen Formulierung führt darüber hinaus dazu, dass manche Aussagen nun schlichtweg nicht mehr „politisch korrekt“ formulierbar sind, zum Beispiel Sätze wie „Frauen sind eben doch die besseren Zuhörer“. Das Beispiel zeigt klar auf: Die verordneten Vorschriften widersprechen zum Teil den Grundregeln unserer Sprache. Sprache dient nämlich sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form einzig und allein der problemlosen Verständigung und nicht der Durchsetzung partikulärer Interessen.
Die trotz jahrzehntelanger intensiver Bemühungen gering gebliebene Akzeptanz der feministischen Vorgaben muss zu denken geben:
•Laut jüngsten Umfragen lehnen 85 bis 90Prozent der Bevölkerung die gegenwärtige Praxis der Textgestaltung im öffentlichen Bereich ab.
•Eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2013 kam zum Ergebnis, dass in Printmedien nur bei 0,5Prozent von Aussagen, die auf beide Geschlechter bezogen sind, getrenntgeschlechtlich formuliert wurde.Die feministisch motivierten Grundsätze zur „sprachlichen Gleichbehandlung“ basieren auf einer einseitigen und unrichtigen Einschätzung der Gegebenheiten in unserer Sprache. Das „generische Maskulinum“ (z.B. Mensch, Zuschauer...) zum Feindbild zu erklären und dessen Abschaffung zu verlangen blendet die Tatsache aus, dass unsere Sprache ebenso ein „generisches Femininum“ (z.B. Person, Fachkraft...) und ein „generisches Neutrum“ (z.B. Publikum, Volk...) kennt. Alle seit Jahrhunderten als Verallgemeinerungen gebrauchten Wörter umfassen prinzipiell unterschiedslos beide Geschlechter. Die angeführten Beispiele beweisen dies.
Es kann also weder die Rede davon sein, dass das jeweils andere Geschlecht nur „mitgemeint“ sei, noch dass das „generische Maskulinum“ ein „geronnener Sexismus“ wäre und für die Unterdrückung der Frau in der Sprache stünde. Die Sprachfrequenzforschung belegt ganz im Gegensatz dazu überzeugend, dass der feminine Artikel „die“ in allen Arten von Texten um ein Vielfaches häufiger repräsentiert ist als der maskuline Artikel „der“.
Folgende aus den angeführten irrigen Grundannahmen entstandenen Verunstaltungen des Schriftbildes sind daher wieder aus dem Schreibgebrauch zu eliminieren:
•Binnen-I, z.B. KollegInnen
•Schrägstrich im Wortinneren, z.B. Kolleg/innen
•Klammern, z.B. Kolleg(inn)en
•hochgestelltes „a“ bzw. „in“ im Anschluss an bestimmte Abkürzungen, z.B. Mag.a, DIinAlle genannten schriftlichen Verunstaltungen entsprechen einerseits nicht dem derzeit gültigen „Amtlichen Regelwerk“ zur deutschen Rechtschreibung, andererseits enthalten sie zum Teil grammatische oder sprachlogische Fehler und können in den angebotenen Formen nicht unmittelbar gelesen werden. (Näheres dazu ist in diversen Publikationen von Brühlmeier, Kubelik, Pohl u.a. nachzulesen.) Darüber hinaus erscheinen die femininen Formen in solchen Konglomeraten jeweils nur als „Anhängsel“ der maskulinen, wobei die maskulinen Formen durch „Anhängsel“ ebenfalls entstellt werden – keines von beiden Geschlechtern kann sich damit respektvoll angesprochen fühlen.
Auch auf die Forderung, ausweichende Formulierungen zu suchen, ist zu verzichten, weil der Schreiber durch krampfhaftes Suchen nach Ersatzformen häufig vom Wesentlichen des Inhalts abgelenkt wird und andererseits der Leser durch gekünsteltes Wortgut irritiert wird.
Außerdem muss gewährleistet sein, dass durch die traditionsgemäße Anwendung verallgemeinernder Wortformen die Verständlichkeit von Texten wieder den Vorrang vor dem Transport feministischer Anliegen eingeräumt bekommt. Dies vor allem im Hinblick auf
•Kinder, die das sinnerfassende Lesen erlernen sollen,
•Menschen, die Deutsch als Fremdsprache erwerben und
•Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Blinde, Gehörlose, Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten).In Schulbüchern dürfen daher nicht länger sprachlich zerstörte Texte stehen wie „Sie/Er verbindet ihr/ihm die Augen und führt sie/ihn an der Hand zu ihrer/seiner Garderobe.“ In amtlichen Texten und Formularen dürfen nicht länger entstellte Formulierungen zu finden sein wie „Unterschrift ZeichnungsberechtigteR“. Studenten sollen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten nicht länger höheres Augenmerk auf das „richtige Gendern“ zu legen haben als auf den Inhalt ihrer Arbeit (siehe das Interview mit Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner in „News“ 31/2013).
Basisdemokratische Sprache
Sprache war und ist immer ein Bereich, der sich basisdemokratisch weiterentwickelt: Was die Mehrheit der Sprachteilhaber als richtig empfindet, wird als Regelfall angesehen. Wo immer im Laufe der Geschichte versucht wurde, in diesen Prozess regulierend einzugreifen, hatten wir es mit diktatorischen Regimen zu tun. Das staatstragende Prinzip Demokratie verbietet daher a priori sprachliche Zwangsmaßnahmen, wie sie derzeit überhandnehmen.
Ein minimaler Prozentsatz kämpferischer Sprachfeministinnen darf nicht länger der nahezu 90-prozentigen Mehrheit der Staatsbürger seinen Willen aufzwingen.
Der Entwurf der ÖNORM A1080, der die öffentliche Debatte zu diesem Thema ausgelöst hatte, präsentiert einen Vorschlag, der die feministischen Anliegen maximal berücksichtigt, aber andererseits eine Rückkehr zur sprachlichen Normalität ermöglicht. Die Unterzeichnenden plädieren daher mit Nachdruck dafür, diesen Entwurf auch auf höchster politischer Ebene zu unterstützen und zur Grundlage der Textgestaltung im öffentlichen Bereich zu erklären.
Gezeichnet:
Dr. Annelies Glander, Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien
Dr. Tomas Kubelik, Gymnasiallehrer, Autor des Buches „Genug gegendert“, Melk
Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz-Dieter Pohl, ehem. Professor für Sprachwissenschaft, Universität Klagenfurt
Em. o. Univ.-Prof. Dr. Peter Wiesinger, em. Ordinarius für germanistische Sprachwissenschaft, Universität Wien
Univ.-Prof. Dr. Herbert Zeman, Literaturwissenschaftler, Universität Wien
sowie rund 800 mitunterzeichnende Universitätsprofessoren, Lehrer, Journalisten und andere Sprachkritiker, darunter
Konrad Paul Liessmann, Peter Kampits, Rudolf Taschner, Heinz Mayer, Klaus Albrecht Schröder, Bastian Sick, Chris Lohner, Werner Doralt, Gudula Walterskirchen, ...E-Mails an: debatte@diepresse.com
("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2014)
unlesbar–unverständlich–unzumutbar!(Stand15. Juli 2014)Ausschnitt aus dem Zahnärztegesetz§ 41. (1) Wenn eine Person, die behauptet, durch Verschulden eines/einer Angehörigen deszahnärztlichen Berufs (in der Folge: Schädiger/Schädigerin) im Rahmen seiner/ihrer Behandlunggeschädigt worden zu sein (in der Folge: Geschädigter/Geschädigte), schriftlich eineSchadenersatzforderung erhoben hat, so ist der Fortlauf der Verjährungsfrist von dem Tag an, anwelchem der/die Schädiger/Schädigerin, sein/seine bzw. ihr/ihre bevollmächtigter/bevollmächtigteVertreter/Vertreterin oder sein/ihr Haftpflichtversicherer oder der Rechtsträger jenerKrankenanstalt, in welcher der/die genannte Angehörige des zahnärztlichenBerufs tätig war,schriftlich erklärt hat, zur Verhandlung über eine außergerichtliche Regelung der Angelegenheitbereit zu sein, gehemmt.(2) Wenn ein/eine Patientenanwalt/Patientenanwältin oder eine zahnärztlichePatientenschlichtungsstelle vom/von derGeschädigten oder Schädiger/Schädigerin oder voneinem/einer ihrer bevollmächtigten Vertreter/Vertreterinnen schriftlich um Vermittlung ersucht wird,so ist der Fortlauf der Verjährungsfrist von dem Tag an, an welchem dieses Ersuchen beim/beider Patientenanwalt/Patientenanwältin oder bei der zahnärztlichen Patientenschlichtungsstelleeinlangt, gehemmt....Anmerkung:Wirklich konsequenteingehalteneGenderpflicht führt beim „Patientenanwalt“ zu Schreibformen wie„PatientInnenanwältin/anwalt“ oder„Patientinnenanwältin/Patientinnenanwalt/Patientenanwältin/Patientenanwalt“Aus dem Internetportal der Stadt GrazEin Hausarzt bzw. eine Hausärztin ist ein(e) niedergelassene(r) (freiberufliche(r)) odereinineinem Medizinischen Versorgungszentrum angestellte(r) Arzt oder Ärztin,derfür die Patientenund Patientinnen meist die erste Anlaufstelle bei medizinischen Problemen ist.(Zitiert nach Kubelik,Genug gegendert,S. 84)Anmerkung: Bei den unterstrichenen Wörtern fehlt das Gender-Splitting. Selbst Gender-Bemühte halten den Wahnsinnsprachlich nicht durch!Formulierungen in Schulbüchernmüssendurchgehend getrenntgeschlechtlich formuliertwerden, also z. B.... inArbeitsanweisungen:„Jede/r, der/m dazu etwas einfällt, schreibt ihre/seine Ideen auf einen Zettel und gibt ihn anihre/ihren/seine/seinen Nachbarin/Nachbarn weiter.“... inSpielregeln(am Beispiel Völkerball):„...Jede Frauschaft/Mannschaft versucht, möglichst viele SpielerInnen der gegnerischenFrauschaft/Mannschaft zu treffen und damit „abzuschießen“. Fängt aber die/der getroffeneSpielerIn den Ball, ist sie/er nicht „abgeschossen“, sondern wird selbst zur/zum WerferIn.
Meint jemand, dass sein © verletzt wurde, bitte ich um Nachricht, damit die betroffenen Inhalte raschest entfernt werden können. Kommentare sind willkommen!


 November
November 
 Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein KURIER/Michaela Reibenwein
KURIER/Michaela Reibenwein APA/HERBERT P. OCZERET
APA/HERBERT P. OCZERET Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Kurier/Seiser
Kurier/Seiser Michaela Reibenwein
Michaela Reibenwein APA/HERBERT P. OCZERET
APA/HERBERT P. OCZERET Weitere Bildergalerien
Weitere Bildergalerien






























