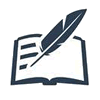Moral fühlt sich jedoch nicht nur gut an, sie verschafft auch eine wunderbare rhetorische Ausgangposition, mit der man etwaige Gegenargumente im Keim ersticken kann. Wer es wagt, zumindest in Erwägung zu ziehen, ob Atomkraft vielleicht doch eine sinnvolle Übergangstechnologie ist, wer – wie ein ehemaliger Bundespräsident – darauf hinweist, dass es notwendig sein könnte, die Freiheit der Handelswege, also wirtschaftliche Interessen, mit militärischen Mitteln zu verteidigen, wer gegen Quotenregelungen argumentiert oder dafür, dass Einwanderungspolitik sich an den Interessen des aufnehmenden Staates zu orientieren hat, der bekommt umgehend den geballten Zorn der Empörten und Selbstgerechten zu spüren. Und da Moralisten in dem Bewusstsein leben, das Gute an sich zu vertreten, sind etwaige Kritiker zum verbalen Abschuss frei gegeben und werden, je nach Thema und Ausgangslage, als neoliberal, kapitalistisch, militaristisch, sexistisch oder zumindest als verantwortungslos gebrandmarkt.
Doch allein die Tatsache, dass wir in der Lage sind, normative Ziele zu verfolgen, die unseren Instinkten widersprechen – also etwa auf Burger, Schokoriegel und Pommes Frites zu verzichten –, zeigt, dass Menschen in der Lage sind, sich Regeln zu setzen, die ihrer Natur entgegenstehen. Diese Form der Selbstbeschränkung nennt man Kultur. Kurz: Kultur ist Triebunterdrückung. Das wusste auch schon Freud.("Unsere Kultur ist ganz allgemein auf der Unterdrückung von Trieben aufgebaut." Jeder einzelne hat ein Stück seines Besitzes, seiner Machtvollkommenheit, der aggressiven und vindikativen Neigungen seiner Persönlichkeit abgetreten; aus diesen Beiträgen ist der gemeinsame Kulturbesitz an materiellen und ideellen Gütern entstanden“ (Sigmund Freud, Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität, in: Ders., Gesammelte Werke, Band VII, S. 149).1)
Diese exklusiven Regelwerke nennen wir Moral. Moral hat also eine doppelte Aufgabe: Sie hilft uns, mit unserer Freiheit umzugehen und zugleich unsere Triebe zu kanalisieren. Deshalb hat jede Kultur solche exklusiven moralischen Regeln. Und es ist alles andere als ein Zufall, dass solche moralischen Regeln zumeist jene Bereiche betreffen, in denen unsere biologischen Instinkte besonders ausgeprägt sind: Sex, Nahrung und Gewaltanwendung.
Solche moralischen Regelwerke sind natürlich kein Selbstzweck, und vom Himmel gefallen sind sie auch nicht. Ihr Sinn und Ziel ist es, dem Menschen dort unhinterfragbare Handlungsregeln an die Hand zu geben, wo seine reduzierten Instinkte versagen. Moral ist evolutionsbiologischer Instinktersatz und Freiheitskompensation.
So unterschiedlich die Lebensbedingungen der Menschen sind, so sehr unterscheiden sich ihre Moralvorstellungen. Was in einer postindustriellen Millionenstadt sinnvoll sein kann, etwa serielle Monogamie, würde in einem Nomadenstamm zu einer sozialen Katastrophe führen. Daher gilt: Was in der einen Kultur erlaubt ist, ist in der anderen verboten. Was die eine Kultur gutheißt, ist in einer anderen eine Todsünde. Moral gibt es nur im Plural.
Doch moralische Konflikte entstehen zunächst nicht zwischen verschiedenen Kulturen, sondern vor allem innerhalb einer Moralgemeinschaft: Denn zum Phänomen Moral gehört, dass man sich gegen sie entscheiden kann. Wo Moral ist, ist Unmoral nicht weit. Gerade weil Moral unsere Handlungsoptionen vervielfachen soll, haben wir die Möglichkeit, uns gegen sie zu entscheiden.
Auf den ersten Blick erscheint das paradox. Ist es aber nicht. Wären moralische Regeln ähnlich unveränderbar wie Instinkte, bräuchten wir sie nicht. Moral ist dafür da, um hinterfragt zu werden. Sonst wäre sie überflüssig. Für das Überleben der Menschheit und ihre Anpassungsfähigkeit an neue Lebensbedingungen bedarf es also des Sünders, zumindest des Nonkonformisten.
Doch nicht nur aufgrund innerer und äußerer Veränderungen einer Gemeinschaft sind deren Moralvorstellungen permanenten Spannungen ausgesetzt. Auch dort, wo zwei unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen, kommt es naturgemäß zu Konflikten. Denn das oberste Gebot jeder Moral lautet: Du sollst keine andere Moral haben neben mir. Moralen sind nicht pluralistisch und nicht tolerant. Das wäre widersinnig. Moralen sind autoritär. Sonst erfüllen sie nicht ihre Funktion. Deshalb unterliegen sie einer bipolaren Logik: wahr oder falsch, erlaubt oder verboten. Dazwischen gibt es wenig.
Der Wunsch nach dem guten Leben macht moralisch flexibel und kompromissbereit.
Ethik ist der Versuch, Moral rational zu begründen und zwischen sinnvollen und weniger sinnvollen moralischen Regeln zu unterscheiden.
Ethik ideologisiert das moralische Handeln. Indem sie moralische Überzeugungen nicht als natürlich und ewig hinnimmt, sondern als begründungsbedürftig auffasst, macht sie diese zu Aspekten einer umfassenden Weltanschauung.
Damit verstärkt die Ethik den expansiven Charakter der Moral. Denn das Bewusstsein, rational begründet zu sein, steigert den Universalitätsanspruch moralischer Vorschriften zusätzlich. Wer ihnen widerspricht, hat nicht nur eine andere Lebensweise oder kommt einfach aus einer anderen Kultur – er ist vielmehr irrational, dumm oder bewusst bösartig. Der Zusammenprall unterschiedlicher Moralvorstellungen wird zum Weltanschauungskampf. Aus dem Widerstreit der Moralen wird der Krieg der Ideologien.
Moral, ursprünglich nicht mehr als ein Sammelsurium überlieferter Regeln und Normen, wird dank Ethik intellektuell salonfähig. So verschärft die Intellektualisierung der Moral qua Ethik die Spaltung der Gesellschaft in Traditionalisten und kritische Progressive: Auf der einen Seite steht die moralische Überlieferungen, auf der anderen Seite deren rationale Kritik und die aus ihr abgeleiteten ethischen Normen. Reflexion trifft auf Tradition.
Doch die ethisch begründete Moral ist nicht ausschließlich kritisch und destruktiv. Vor allem den Herrschenden macht sie ein bestechendes Angebot: Sie ist in der Lage, Herrschaftsstrukturen als vernunftbegründet auszuweisen. Darin liegt ihre Stärke, und deshalb setzt sie sich durch. Gründete Herrschaft bis dahin analog zur Moral auf Überlieferung und auf Tradition, so erhebt die ethische Rechtfertigung von Herrschaft universalen Anspruch. Damit schenkt die Ethik der Welt die Herrschaftslegitimation qua angeblicher Vernunft.
Doch eine Moral, die man begründen möchte, lässt sich nur ideologisch begründen. Es gibt keine ideologiefreie Moralbegründung. Also muss man die Ideologie hinter der Moral verschleiern.
Um den Anschein zu erwecken, unideologisch zu sein, muss die Moral selbst zu Ideologie werden. So wird aus der Moral der Moralismus.
Diese Flucht in die Ideologiefreiheit verstärkt jedoch – wie bei jeder Ideologie – die Strenge und Unnachgiebigkeit der angeblich postideologischen Moral. Es entsteht ein neuer missionarischer Puritanismus. Dieser begreift die von ihm vertretenen Werte und Normen nicht nur als evident, sondern weiß sich zugleich beauftragt, dem reinen Guten zum endgültigen Sieg zu verhelfen.
Denn das reine Gute gibt es nicht. Das Gute ist immer unrein. Es ist gut, weil es aufgrund seiner Verortung in einem ideologischen Koordinatensystem als gut angesehen wird.
Aufgrund seines objektivistischen Anspruchs radikalisiert der postideologische Moralismus den ohnehin vorhandenen expansiven Charakter von Moral. Wer den von ihm proklamierten Normen und Werten widerspricht, ist entweder intellektuell nicht in der Lage, das allein Gute und Wahre zu erkennen oder aus psychologischen Gründen dazu nicht gewillt. Anders gesagt: Wer sich dem herrschenden Moralismus widersetzt, ist entweder einfältig oder ein pathologischer Fall.
Nach Arnold Gehlen ist Humanitarismus „die zur ethischen Pflicht gemachte unterschiedslose Menschenliebe“ (Arnold Gehlen, Moral und Hypermoral, Wiesbaden 1986, S. 79.
Doch diesem Denken liegen zwei Verwendungen des Begriffs „normal“ zugrunde. Die statistische: Normal ist, was die Mehrheit denkt, macht oder tut. Und eine normative: Normal ist, was toleriert werden muss, auch wenn es gar nicht normal im statistischen Sinne ist. Postmoderne Gesellschaften neigen dazu, den statistischen Normalitätsbegriff durch den normativen Normalitätsbegriff zu ersetzten: Alles ist normal, auch wenn es gar nicht normal ist.
Das ist der einfache Grund dafür, dass sozialer Gerechtigkeit in individualistischen Gesellschaften eine so hohe Bedeutung zukommt. Bestand die traditionelle Gerechtigkeit darin, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, so wittert der Gläubige des zeitgenössischen Gerechtigkeitskultes genau darin einen Skandal. Denn aus seiner Sicht besteht Gerechtigkeit in der absoluten Inklusion: alle haben gleich zu sein, auch wenn sie nicht gleich sind. Und sozial gerecht ist, was Gleichheit schafft wo Ungleichheit war. Aus dem Kult um die soziale Gerechtigkeit folgt notwendigerweise der Imperativ der totalen Toleranz. Denn wenn alle gleich sind – auch die, die nicht gleich sind –, dann hat die Gemeinschaft jede Form individueller Emanzipation zu tolerieren, und sei sie noch so absurd. Da aber Toleranz im Grunde nur bedeutet, dass die jeweiligen Lebensentwürfe ertragen werden, das postmoderne Individuum aber mehr möchte, nämlich echte Anteilnahme, ja Applaus für seine Selbstinszenierung, fordert es notwendigerweise Akzeptanz und absolute Offenheit. Wir alle haben alles zu akzeptieren und offen zu sein, besser noch „voll offen“ für alles und jedes. Alles andere wäre Diskriminierung.
Bedingung für die Grundlagen moderner Massengesellschaften war die Überwindung der Güterknappheit.13 Es ist nicht ohne Ironie, dass das Leben in dem Moment sinnlos wurde, in dem das Ziel des Lebens nicht mehr darin bestand, zu überleben. In diese Lücke des Lebenssinns springt der Konsum. Ziel des Lebens ist es nun, möglichst viel und möglichst intensiv zu konsumieren: Güter, Erfahrungen, Menschen, Waren, Ereignisse.
Man beginnt in Kategorien wie „in“ und „out“ zu denken, wobei etwas „out“ ist, sobald die Masse begriffen hat, das es „in“ ist.